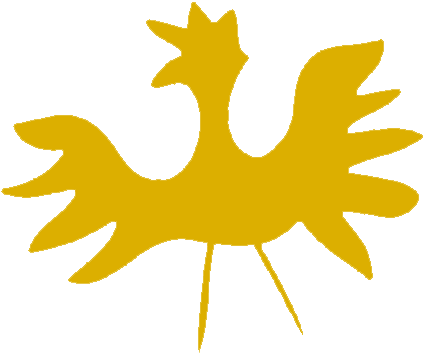Vom Heim ins Leben
Bis in die 1970er Jahre hinein kann nur in seltenen Fällen von einer Nachbetreuung und Unterstützung für die Integration in das Leben außerhalb des Heimes gesprochen werden. Oft war die Nachbetreuung nichts anderes als die Fortsetzung der Kontrolle und des Drucks des Heimes. Hans Weinert, Leiter des Erziehungsheimes Kleinvolderberg, der später in eine führende Position eines Bezirksjugendamtes aufrückte, schildert, dass es einiger Mühen und Zeit bedurfte, bis eine größere Professionalität und mehr Verständnis in dieser Frage in den Ämtern herrschte. Wesentlichen Anteil an einer Verbesserung der Lage hatten engagierte SozialarbeiterInnen und Gruppen wie der Arbeitskreis Heimerziehung oder der Verein für Soziale Arbeit und die Bewährungshilfe.
Eine psychologisch betreute siebenköpfige Gesprächsrunde fasste ihre Erfahrungen nach dem Heimaufenthalt so zusammen: „Niemand hat sich um uns gekümmert, wir sind auf der Straße gestanden.“ Hans Berger berichtet: „Als ich 18 war, sagte mir Erzieher A, ich bin frei und muss das Heim sofort verlassen, ohne jede Unterstützung mit einer blauen Arbeitsmontur und Gummistiefel. So stand ich vor der Tür und wußte nicht wohin, ohne Geld, ohne Arbeit, ohne Ziel. Eltern und Verwandte waren für mich gestorben, da führte kein Weg hin. Von der ganzen Welt im Stich gelassen, meiner Kindheit beraubt und fallen gelassen wie ein Stück Dreck. Unerziehbar entlassen, ausgenützt, betrogen, bestohlen, enttäuscht von Menschen, vor denen man Achtung haben sollte. Nach meiner Heim-Entlassung hauste ich in Heustadeln oder in Schrebergartenhäuschen, gelebt habe ich von Diebstählen. Später habe ich in der Rossau (Mülldeponie) in einem alten Bus gewohnt und habe junge Leute von der Bocksiedlung kennengelernt, mit denen ging ich nachts einbrechen. Sonst hat sich um mich niemand gekümmert.“ Auch Ludwig Brantner erlebte Ähnliches und wusste nicht, wohin er sich wenden sollte: „Manchmal fragte ich mich, ob ich überhaupt ein Interesse an meiner Zukunft hatte. Das Leben war mir total egal, mein Zustand war mir gleichgültig. Es gab niemanden, den ich gern hatte, niemanden, der mich mochte. Wofür sollte ich überhaupt leben? Nur das Trinken gefiel mir.“ Der Weg in die Kriminalität und Prostitution war in solchen Situationen für viele heimentlassene Jugendliche bereits vorgezeichnet.
Auch die jungen Frauen, die aus Schwaz entlassen worden waren, standen vor ähnlichen Problemen. Die Interviewten konnten sich höchstens als Hilfsarbeiterinnen verdingen. Dabei stellte sich bei den Befragten heraus, dass die meisten sehr früh und oft unfreiwillig schwanger wurden und, sofern der Mann sie nicht im Stich ließ, auch dementsprechend früh heirateten. Die finanzielle Lage aller Interviewten war in der Zeit nach der Entlassung aus dem Heim äußerst trist. Hermine Reisinger berichtet, dass sie mit einem bescheidenen Geldbetrag und der Aufforderung vor die Türe gestellt worden sei, nun etwas aus sich zu machen. Roswitha Lechner fühlte sich, als sie die Tore von St. Martin hinter sich ließ, „endlich frei“. Da sie aber mittellos und noch nicht volljährig war, musste sie in den verhassten Haushalt der Mutter zurück und sich ihren Vorstellungen, Regeln und Plänen fügen. Die Fabrikarbeiterin hauste mit ihr und der Schwester zu dritt in einem Zimmer. Durch die frühe Heirat gelangte sie schließlich unter die Kontrolle des Mannes.
Die aus den Kinderheimen Entlassenen wurden, sofern sie nicht in ein Erziehungsheim kamen, wieder in ihre Herkunftsfamilien zurückgeschickt. Dort ging es dann für die meisten so weiter wie vor der Heimunterbringung. Ihr Alltag bestand aus Schlägen, Demütigungen und Vernachlässigung. Die Jugendämter waren in erster Linie daran interessiert, dass diese Jugendlichen auf dem rechten Weg blieben. Das hieß, einer regelmäßigen Arbeit nachzugehen, sich sittlich einwandfrei zu benehmen und vor allem nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Dies hatte Priorität. Psychische und physische Gewalt, der diese Jugendlichen wieder ausgesetzt waren, kümmerte die Fürsorgerinnen weit weniger. Es wurde nicht sorgfältig nachgesehen und auch den Betroffenen nicht geglaubt. Wenn sie den Behörden nicht mehr auffielen, war die Fürsorgeerziehung erfolgreich gewesen.
Ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre sind auch positive Entwicklungen zu vermerken. Die Bubenburg in Fügen führte für die Nachbetreuung eine Wohngemeinschaft am Rennweg in Innsbruck. Die Benediktinerinnen stellten ihren Heimkindern auf der Weiherburg in Innsbruck ein Lehrlingswohnheim zur Verfügung, wo sie freundlich behandelt wurden. Da Aloisia Wachter aber von ihren Erfahrungen in Martinsbühel derartige Aggressionen gegen geistliche Schwestern entwickelt hatte, konnte sie mit Hilfe einer Sozialarbeiterin in ein Mädchenheim des SOS-Kinderdorfes überwechseln. Dort wurde sie Schritt für Schritt an die Anforderungen eines eigenständigen Lebens herangeführt. Christine Specht übersiedelte in ein Mädchenwohnheim in Vorarlberg, von dem sie noch heute schwärmt.