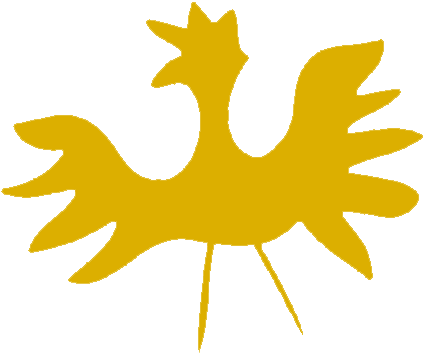Raum und ZeiT
„Das waren 10 Jahre Gefängnis. 10 Jahre meines Lebens habt ihr mir gestohlen.“ Diese Aussage von Mercedes Kaiser über ihre Zeit im Landeserziehungsheim Kramsach-Mariatal kennzeichnet das Innen und Außen der Kinder- und Erziehungsheime. Von den Befragten werden sie charakterisiert als Gefängnis, Verlies, Haft, Kleinfolterberg, Stachelburg, Haus der Tausend Tränen, Hölle auf Erden oder Nordkorea. Diese Begriffe verweisen auf die Erziehungsmethoden, vor allem aber auch auf die Abgeschlossenheit und Isolierung. Die Kinder fühlten sich eingesperrt, ihrer Freiheit beraubt und an einem Ort verwahrt, von dem es kein Entkommen gab. Nachts waren sie eingeschlossen.
Zur Außenwelt gab es feste Grenzen, die Innenwelt war von einem dichten Regelwerk bestimmt, das von außen nicht beeinflusst wurde und den Tagesablauf, ja das ganze Leben der Heranwachsenden reglementierte. Julia Wegner gibt an, sie habe „alles nur grau und schwarz wahrgenommen, es war so düster, es war so depressiv, es war überhaupt nichts Schönes oder Erfreuliches da für uns Kinder.“ Walter Müller fühlte sich als Teil einer anonymen Masse, als Nummer, die durchgeschleust wird, die niemanden interessiert. Nicht nur der Umgang mit den Kindern, auch der Raum, in dem sie sich aufhielten, trug zu einer Entindividualisierung bei. Selten wurden sie als Einzelne wahrgenommen, fast immer nur als Gruppe oder als Teil von ihr. Die Einschließung und die Raumaufteilung zielten auf eine ständige Kontrolle und einen reibungslosen Ablauf ab. Diesem Prinzip war auch die Beschulung untergeordnet. Außer in den städtischen Kinderheimen Mariahilf und Pechegarten in Innsbruck, wo die Kinder und Jugendlichen außerhalb der Anstalten in die Klasse gingen, wurden sie in Schulen unterrichtet, in denen sich nur Heimkinder befanden und dies noch dazu innerhalb der dicken Anstaltsgemäuer.
Der Raum sorgte im Heim neben der Isolierung und Kontrolle generell für Ordnung. Damit stellte er indirekt eine wichtige Erziehungsmethode dar. Es gab Räume für Belohnungen und Bestrafungen und solche, die nach Alter und Geschlecht sortierten, vor allem aber nach dem Prinzip von Gut und Böse. Der Raum wies den Heranwachsenden einen Platz in der Anstaltshierarchie zu und regulierte das Verhalten. Im Landeserziehungsheim Kramsach-Mariatal und den Fürsorgeerziehungsanstalten St. Martin in Schwaz und Kleinvolderberg entsprach die Raum- und Gruppeneinteilung dem Grad der Bewährung im Heim. In die erste Gruppe kamen die Neulinge, in der letzten standen die Jugendlichen vor der Entlassung. In Schwaz, ganz besonders in Kleinvolderberg, war die Anfangsgruppe die „Geschlossene“. Eine sonstige Klassifizierung der Kinder und Jugendlichen nach zunehmendem „Verwahrlosungsgrad“ und Trennung der „Normalen“ wurde auch innerhalb der Tiroler Heime angestrebt, stieß aber an die – vor allem finanziellen – Grenzen der Durchführbarkeit. Die exzessive Sauberkeit, die verlangt wurde, entsprach einer symbolischen Erziehungsmethode für die geistig und moralisch als unsauber angesehenen Kinder und Jugendlichen. Orte des Rückzuges, der Intimität und Privatheit waren nicht vorhanden, sollten auch nicht vorhanden sein, da dies der Kontrolle widersprochen hätte und der Priorität der Erziehung in der und durch die Gruppe. Auch die materielle Ausstattung war schlecht.
Gerade die Schlafstätten repräsentieren besonders die Raumaufteilung in den Heimen. In den katholischen Anstalten waren die Massenschlafsäle meist panoptisch strukturiert, also von überall einsehbar und dies auch noch in den 1970er Jahren. Die Schlafordnung war ebenso rigide und drückte die herrschende Lieblosigkeit aus. Nächtens stieg die Sehnsucht der Kinder nach Schutz und Geborgenheit. Die endlos vielen Strafen und die Strenge, mit der ihnen zur Herstellung der Nachtruhe begegnet wurde, vervielfachten das Gefühl der Verlorenheit.
Immer wiederkehrend sind die Berichte über schier endlose und furchterregende Gänge in den klösterlichen Kinder- und Erziehungsheimen. Die riesigen Gebäude schüchterten ein und versinnbildlichten, wie unbedeutend und klein man war. Die klare Definition von Innen und Außen schloss auch die strenge Kontrolle mit ein, wer das Heim verlassen und betreten durfte. Dies betraf nicht nur die Zöglinge selbst, sondern auch Eltern und Geschwister, die generell als Störenfriede empfunden wurden. Die Befragten erzählen, dass die Besuchsmöglichkeiten in Bezug auf die Häufigkeit und Zeitdauer sehr eingeschränkt waren und sie während der Besuchszeit selten allein mit ihren Angehörigen sein konnten. Schon allein die Sitzordnung erschwerte eine körperliche Nähe. Über die in allen Heimen striktest durchgeführte Briefzensur erzählt Julia Wegner: „Monatelang wartete ich auf Post, aber es kam nichts. Das hat mich total fertiggemacht. Als Kind geht man so weit, dass man denkt, die Mama ist tot. Später habe ich erfahren, dass sie mir im Kloster die Post unterschlagen haben.“
Raum und Zeit waren als Ordnungs- und Erziehungsfaktoren eng miteinander verschränkt. Alle Befragten klagen darüber, dass sie völlig fremdbestimmt waren, was die Zeiteinteilung anlangte. Aloisia Wachter bringt es auf den Punkt, wenn sie von einem Tagesablauf spricht, der wie in einer Kaserne geregelt und durchkomponiert war. Die Berichte gleichen einander. Zeitiges Aufstehen, eventuelle Untersuchung der Betten und Unterhosen nach Exkrementenspuren, hastige Körperpflege, Zimmerreinigung, eine Vielzahl an Gebeten und religiösen Übungen in den meisten, vor allem von Orden geführten Heimen, die den Tag begleiteten, Schule und Arbeit, feste Ruhezeiten zu Mittag und für Studierstunden, häufige Sprechverbote, karge Freizeit, frühe Bettruhe. Dieses feine Zeitgitter entsprach der Organisation eines Massenbetriebes. Müßiggang sollte verhindert werden und die Kinder keine Gelegenheit haben, auf dummen Gedanken zu kommen. Das enge Stundenkorsett war dazu da, die nach Meinung der Heimleitungen an Strukturlosigkeit leidenden Heranwachsenden an den rationalen und effizienten Umgang mit Zeit zu gewöhnen. Der folgende Tagesablauf in der Bubenburg wird deshalb beschrieben, um zu zeigen, wie lange diese totale Fremdbestimmung andauerte und wie lange sie als pädagogisch sinnvoll gerechtfertigt wurde. Pater Erich Geir, der Leiter der Bubenburg, beschrieb einen Tag in Fügen Mitte der 1990er Jahre (!) so:
„Die Kinder stehen um 6.45 Uhr auf, dann gibt es Frühstück. Um 7.30 gehen sie in die Schule und um 7.40 beginnt der Unterricht, der bis 13.20 Uhr dauert. In der Volksschule dauert er nur bis 11.30 Uhr. Nach der Schule gibt es das Essen und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr ist Freizeit. Danach beginnt die Lernzeit bis 18.00 Uhr. Um 18.00 Uhr gibt es das Abendessen, von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr ist wieder Freizeit. Um 20.00 Uhr schicken sie sich langsam an, daß sie in ihre Kojen gehen. Um ca. 21.00 Uhr ist dann Schluß, dann sollten sie eigentlich schlafen gehen.“
Generell waren in den Heimen die freien Zeiten gering bemessen und wenig abwechslungsreich, das Angebot dürftig, Begabungsförderungen minimal. Vielfach ging es um eine Ruhigstellung, weshalb körperliche Ertüchtigungen und Wanderungen, klassische Freizeitangebote von Heimen, den stärksten Stellenwert einnahmen. Davon erhofften sich die Heimleitungen auch die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und des Vertrauens in die ErzieherInnen. Sport sah man überdies als probates Mittel gegen sexuelle Anfechtungen und Aggressionen an. Mädchen wurden aber selbst in ihrer Freizeit übermäßig mit hauswirtschaftlichen Arbeiten und „frauengemäßen“ Tätigkeiten wie Putzen und Handarbeiten überhäuft. Oft wurde im Chor gesungen, zumeist geistliches Liedgut oder Lieder mit patriotisch-militärischem Unterton.
Die Befragten unterstreichen unisono, dass selbst Freizeitbeschäftigungen an ein Wohlverhalten gekoppelt waren und sofort eingeschränkt wurden, wenn es Regelverstöße gab. Das Einlernen von Theaterstücken, bunte Abende im Fasching und Feiern stellten die eindrucksvollste Abwechslung im monotonen Alltagstrott dar. Die Burschen konnten auch an sportlichen Wettkämpfen und Schiwochen teilnehmen. Sommerlager, wie sie die Heime Westendorf oder die Bubenburg in Fügen unternahmen, waren für viele Kinder eine Möglichkeit, die sie aufgrund ihrer Armut ansonsten nicht wahrnehmen hätten können. Aus den Erzählungen geht hervor, dass diejenigen, die in solchen Lagern nicht geschlagen oder sexuell missbraucht wurden, schöne Tage erlebten.