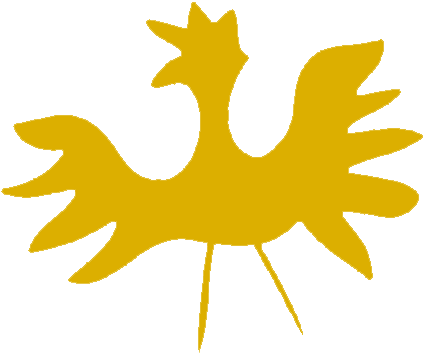Arbeitszwang statt Bildung
Mangelnde Berufsausbildung ging in den Heimen Hand in Hand mit einer unzureichenden Schulbildung. Ein großer Teil der Befragten wurde unabhängig von ihrem sichtbaren oder erst noch zu fördernden Potential in eine Sonderschule gesteckt. Über einen Pflichtschulabschluss hinaus kam kaum jemand.
Die Berufswahl sah oft so aus: Als der Berufsberater kam, habe er dem 14-Jährigen gleich Schläge angedroht, als dieser seinen Berufswunsch äußerte, der nicht in das Konzept des Beraters passte, erzählt Markus. Unter einem enormen zeitlichen Druck wurden ihm wie auch den anderen Buben einige wenige burschenspezifische Handwerksberufe aufgezählt: „Innerhalb von fünf Minuten entschied sich meine ganze Zukunft.“ Auch Aloisia Wachter berichtet, dass sie nach dem erzwungenen Besuch der Sonderschule in Martinsbühel in der angegliederten einjährigen Haushaltungsschule zwar ein ausgezeichnetes Zeugnis bekam, doch das Jugendamt bestimmte noch 1983, dass sie eine kaufmännische Lehre absolvieren musste, obwohl ihr das widerstrebte. Ihrem Wunsch könne nicht entsprochen werden, da die Lehrherren ihr aufgrund des Sonderschulbesuchs negativ gegenüber stünden.
Selbst 1980 befanden sich von den rund 50 weiblichen Jugendlichen im Erziehungsheim Schwaz nur vier in einer Lehre. Laut Heimleitung hätten die Mädchen alle Möglichkeiten für eine ordentliche Berufsausbildung, doch sie würden nicht wollen. Eine der jungen Frauen berichtete in der Fernsehsendung „Teleobjektiv“, in der diese Befunde erhoben wurden, dass man zu ihnen sagen würde: „Bist eh zu deppert.“ Immer noch arbeitete die Hälfte der Jugendlichen zu diesem Zeitpunkt im Heim. Es hieß bügeln, häkeln, Küchenarbeit verrichten, in der Waschküche arbeiten und immer wieder putzen und putzen. Die Schikanen waren breit gefächert, der Arbeitszwang total. Die Küchenarbeiten und ganz besonders die landwirtschaftlichen Tätigkeiten im weitläufigen Ökonomiekomplex des Schwazer Areals dienten zur Personaleinsparung und zur teilweisen Deckung ihrer Aufenthaltskosten, die für die öffentliche Hand so niedrig wie möglich gehalten wurden. Das Heim arbeitete auch gewerblich für Privatfirmen und das Bundesheer. Die Abgängerinnen der weiblichen Erziehungsheime beschweren sich alle darüber, dass sie für diese Leistungen wenig bis gar nichts bekommen hätten. Das Taschengeld für die Arbeitstätigkeiten variierte nach Wohlverhalten und wurde zunächst wie der Lohn für Arbeiten im Außendienst auf ein individuelles Heimkonto gut geschrieben, auf das die Mädchen nur auf Anfrage und nach Angabe des Verwendungszwecks Zugriff hatten. Kleinvolderberg befleißigte sich desselben Systems.
Dass die Jugendlichen nicht sozialversichert waren, wurde damit begründet, dass es sich nicht um ein Arbeitsverhältnis, sondern um eine Arbeitstherapie handle.
Die andere Hälfte der jungen Frauen aus St. Martin arbeitete fast ausnahmslos als Hilfsarbeiterinnen, sofern sie sich durch ihr Verhalten für den Außendienst bewährt hatten. Den Mädchen kein oder ein äußerst geringes Entgelt für ihre Arbeit zu zahlen, scheint in den von Ordensgemeinschaften geführten Erziehungsheimen noch ausgeprägter gewesen zu sein.
Bei den Burschen in Kleinvolderberg gestaltete sich die Situation der zu verrichtenden Innen- und Außenarbeiten ähnlich wie in Schwaz. Der Anteil der Burschen im Außendienst lag aber nicht nur viel höher, entsprechend der geschlechtsspezifischen Sichtweise wurde auch viel mehr männlichen Jugendlichen die Möglichkeit eingeräumt, eine Lehre oder beruflich verwertbare Kurzausbildungen zu absolvieren. Dies stellt bereits zu dieser Zeit die Existenz von (Lehr)Werkstätten im Heimbereich selbst unter Beweis. Dennoch berichten ehemalige Zöglinge von argen Mängeln. Besonders in den 1950er und frühen 1960er Jahren waren die Verhältnisse äußerst trist. Hilfsarbeiten jeglicher Art und Arbeitsverrichtungen mit Strafcharakter waren vorherrschend. Es kamen Gewerbetreibende und Bauern in die Anstalt, um sich Burschen als billige Arbeitskraft auszusuchen.
Immer wieder fallen Ausdrücke wie Zwangs- und Sklavenarbeit, die sich nicht nur auf deren Charakter und die Begleitumstände beziehen, sondern auch darauf, dass die Befragten angeben, nicht sozialversichert gewesen zu sein und keine freie Verfügung über ihren karg bemessenen Lohn gehabt zu haben. Emmerich Kuhn kommt noch auf einen weiteren Aspekt neben Ausbeutung und fehlender Sozialversicherung zu sprechen. Die Arbeitskraft wurde von Erziehern immer wieder auch für ihre privaten Zwecke genutzt. Auch in Schwaz erfreute sich etwa die Direktorin der kostenlosen Arbeitskraft ihrer Zöglinge. Sie lebte im Heim standesgemäß und benötigte ein Haus- und Kindermädchen, auch eine Teppichknüpferin durfte ihr zu Diensten sein.
Ob in Martinsbühel, Scharnitz, Kramsach-Mariatal oder Westendorf – auch die schulpflichtigen Kinder mussten arbeiten. Von fließbandmäßiger Küchenarbeit und Massenschuhputz ist bei den Befragten ebenso die Rede wie von „Sklavenarbeit“ am Feld und im Garten für Gottes Lohn.