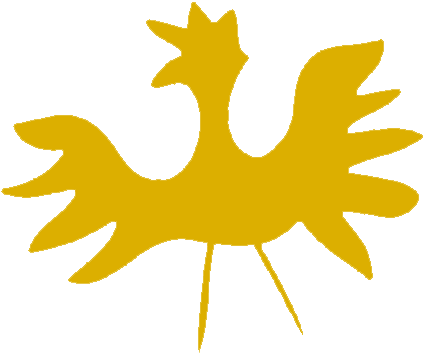Beziehungen
Dass sie einfach gemocht wurden, darüber wissen die ehemaligen Heimkinder in den seltensten Fällen etwas zu berichten. Es ist frappierend, dass sie kaum Zuwendung erfuhren und nur wenige BetreuerInnen positiv erwähnen. Dabei ist die Bereitschaft groß, ErzieherInnen in einem milden Licht zu sehen, wenn diese auch nur kleine Gesten der Anteilnahme zeigten oder wenigstens gröbere Schläge unterließen. Selten, vereinzelt aber doch, gab es ErzieherInnen, welche die Kinder gut behandelten. Wer etwa von einem gefürchteten Heim wie Westendorf nach Innsbruck in den Pechegarten oder auch nach Mariahilf überstellt wurde, konnte den Ortswechsel als wohltuend empfinden, manchmal sogar als schöne Zeit. Wenn jemand, wie etwa eine Schwester in Martinsbühel, den Kindern nur ein wenig Wärme entgegenbrachte, waren sie nicht mehr zu halten, so Aloisia Wachter: „Sie waren wie ein Rudel Schafelen um sie und haben gesagt: ‚Schwester hängen Sie ein.‘“ Eine Erzieherin in Schwaz ragt heraus, die sogar mit ihren eigenen Kindern im Heim blieb, um mit Hermine Reisinger, die völlig alleine dastand, gemeinsam Weihnachten zu feiern.
Aloisia Wachter, die so wie fast alle befragten Heimkinder über das Fehlen von Zuwendung und den Mangel an Geborgenheit klagt, bringt exakt auf den Punkt, wie einige Kinder das, was sie an Bösem erlebten, teilweise positiv zu besetzen versuchten, weil sie nichts anderes kannten: „Für mich war Gewalt, waren Ohrfeigen ein Zeichen von Liebe.“ Walter Müllers Beschreibung seiner Gefühle in Kleinvolderberg entspricht einer Kollektiverfahrung ehemaliger Heimkinder: „Zurückblickend in die damalige Zeit ist fast nichts erhalten geblieben, was angenehme Erinnerungen auslösen könnte. Ein Bild, gemalt in tiefem Grau, kalt umrahmt und irgendwie endlos. Endlos traurig, endlos bitter und endlos hoffnungslos. Ohnmacht gepaart mit Aussichtslosigkeit (…) in Kombination mit Ungerechtigkeit (…). Ich fühlte mich ausgeliefert, verschachert, verkauft, hatte ich doch keinen Wert mehr. (…) Zuneigung oder Verständnis hatten keinen Platz und keine Zeit.“
Es gab eine spezielle Sprache, die von Kinderpsychiaterinnen, Fürsorgerinnen oder Heimleiterinnen verwendet wurde, wenn sie die Anlehnungsbedürftigkeit von Kindern zu Erzieherinnen, aber auch zu anderen Kindern charakterisierten: Dies galt nicht nur als aufdringlich, sondern als „Schmierkontakt“. Ein Nähe suchendes Kind war „schmierig“ oder „klebrig“.
Die ErzieherInnen werden von den Befragten generell als überfordert, nervenschwach, gereizt, distanziert, inkompetent, bösartig und gewalttätig beschrieben, in Einzelfällen fielen Bezeichnungen wie „Verbrecher“ für die sexuell Übergriffigen. In jedem Heim gab es ausgesprochene SadistInnen und SchlägerInnen, die über das übliche Maß hinaus für Furcht und Schrecken sorgten. An Schläge und an eine furchtbare Behandlung waren viele der Befragten als Kinder gewöhnt. Doch das Heim erwies sich für alle Befragte als Ort, an dem man schutz- und rechtlos ausgeliefert war, getrennt von allen Bezugspersonen, die außerhalb der Anstalt lebten. Dazu Julia Wegner: „Mir und meinen Geschwistern ist es zu Hause mit dem Vater sehr schlecht gegangen, aber in Scharnitz war es für uns noch einmal brutaler, weil wir überhaupt nicht gewusst haben, was passiert, warum das alles passiert und wie lange wir in diesem Gefängnis bleiben müssen. Es war die komplette Haltlosigkeit und es gab keinen Ansprechpartner. Daheim konnte ich wenigstens zur Mama gehen oder zu irgendeiner Bekannten. Doch im Heim war einfach niemand.“ Ein Gefühl, ausgelöst durch die permanenten Schikanen, beherrschte viele, zum Teil bis heute: Hass.
In ein und demselben Heim konnten ErzieherInnen, die ansonsten wüteten, sich gegenüber Kindern und Jugendlichen auch ganz anders verhalten, wenn die Eltern regelmäßig zu Besuch kamen oder das Kind freiwillig ins Heim gebracht hatten. Waren Heim- und Internatskinder in derselben Anstalt, wenn auch voneinander räumlich getrennt untergebracht, so widerfuhr ihnen zumeist eine unterschiedliche Behandlung. „Wir [Fürsorgekinder] waren eine eigene Klasse oder Rasse, die unterste Schublade“, betont Julia Wegner ausdrücklich.
Die erzieherische Generallinie in den Heimen war es, Freundschaften zu verhindern. In den Führungsberichten der Heimleitung von St. Martin in Schwaz tauchen Darstellungen von „abnorm erscheinenden freundschaftlichen Beziehungen“ auf, die sich nicht auf lesbische Verhältnisse bezogen, sondern das altersgemäße Verhalten Jugendlicher meinten: Cliquenbildung, Schwärmereien, Rivalitäten, Eifersüchteleien und Streitigkeiten wegen eingeforderter Exklusivitäten in der Freundschaft usw. DirektorInnen und ErzieherInnen suchten sich Lieblinge aus, denen Vergünstigungen für eine Teilnahme an Kollektivbestrafungen gegenüber KameradInnen gewährt wurden. In einigen Heimen mussten die Kinder und Jugendlichen andere Zöglinge in ritualisierter Form bestrafen. Beliebt war ein Spießrutenlauf oder eine „Watschengasse“. Die Übergriffe der Großen waren zahlreich und wurden von den Erwachsenen mehr gefördert als unterbunden. Überall wurde versucht, ein Spitzelsystem von ZuträgerInnen zu etablieren, das die Kontrolle und Disziplinierung für die Erwachsenen erleichterte. So wurde auch ein ausgeprägtes Misstrauen gesät und ein kaum mehr zu überbietendes Aggressionspotential geschaffen, dem besonders Kinder im Vorschul- und Volksschulalter ausgeliefert waren.
Mercedes Kaiser interpretiert ihre Erlebnisse in Kramsach-Mariatal so, dass die Kinder nicht grausam waren, sondern grausam gemacht wurden. „Gewalt erzeugt Gegenwalt“, sagt Christine Specht. Walter Müller berichtet über Kleinvolderberg nicht nur von den Ängsten in der Nacht, in der die Übergriffe besonders häufig stattfanden, speziell wenn man zu den Neuankömmlingen zählte. Er schildert auch das Dilemma, in dem sich die jungen Leute befanden: „So war es also wichtig, nicht nur schnell herauszufinden, welcher der Erziehungsexperten der unangenehmste war, dasselbe galt auch für die eigenen Reihen. Dann hatte man wieder die Wahl: entweder sich ihnen entgegenzustellen, oder mit ihnen mitzumachen. (…) Und seitens der Heimleitung kümmerte man sich um interne Bubenkämpfe ohnedies nicht.“
Dennoch gelang es nicht, die Solidarität unter Kindern und Jugendlichen zur Gänze zu brechen. Immer wieder kam es zu gegenseitiger Hilfe und Unterstützung, zu Trost und Einfühlungsvermögen. Im Mitleid mit anderen wurde das eigene Selbst erkannt und geschützt.