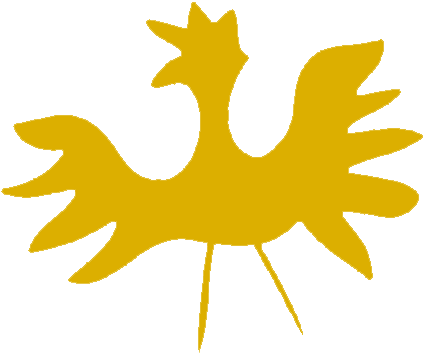Überstellung und ankunft im heim
„Das war der größte Schock in meinem Leben. Da kommt ein Gendarmerieauto, ein alter Käfer, grau, Gendarmen in Uniform, und holt uns drei ab, setzt uns ins Auto hinein. Wir dachten, er fährt uns von den Großeltern nach Hause nach Innsbruck, fährt der uns doch nach Westendorf, ohne Vorwarnung, ohne nichts.“ Diese Erinnerung von Karlheinz L. steht repräsentativ für die kollektive Erinnerung der ehemaligen Heimkinder an ihre Überstellung ins Heim: „Dann haben sie mich abgeholt mit einem schwarzen VW und ab nach Westendorf. Ich war keine sieben Jahre. Warum sie mich geholt haben, ich weiß es nicht, keine Ahnung“, erzählt Franz Pichler.
Die Ankunft gestaltete sich für die Kinder und Jugendlichen ebenso furchteinflößend wie die Abfahrt und Anreise. Ein besonders einschneidendes Erlebnis war die häufige Trennung von den Geschwistern und damit von der einzigen noch verbleibenden Bezugsperson. Roswitha Lechner erfuhr dasselbe Los in St. Martin in Schwaz. Bis zu ihrem Eintreffen im Heim waren sie und ihre Zwillingsschwester unzertrennlich gewesen, nach dem mehrjährigen Aufenthalt war auch diese Beziehung weitgehend zerbrochen. Der erste Eindruck der Anstalt ließ viele verzweifeln: Alles wirkte riesig, grau, uniform, militärisch. Hans Berger fühlte sich in Kleinvolderberg in eine KZ-Kleidung gesteckt, dann ging es sofort ab in den Arbeitsdienst. In der Anfangsgruppe, in der man praktisch eingesperrt war, erhielt er gleich die ersten „gsundn Haustätschn“. Von diesem Begrüßungsritual berichten viele der Befragten. Ludwig Brantner erinnert sich an einen ungarischen Erzieher, „ein ganz schöner Koloss“, der ihn der Gruppe mit dem üblichen „Begrüßungsgeschenk“ vorstellte. Der Junge musste sich vor eine Wand stellen, woraufhin er beide Fäuste des Erziehers mit voller Wucht in die Brust geboxt bekam, dass es ihn gegen die Wand schleuderte. Die umstehenden Zöglinge lachten.
Emmerich Kuhn, ein 15-jähriger Kärntner, der nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, wurde nach Kleinvolderberg mit dem Zug in Handschellen gebracht. Die Scham sitzt bis heute tief.
Sebastian Wolf wurde als Neunjähriger gleich bei seiner Ankunft in Westendorf grundlos geohrfeigt, der Fürsorgebeamte stand tatenlos daneben.
Christine Specht hatte zwar das Glück, mit ihrer Mutter ins Kinderheim Mariahilf zu fahren. Dort las sie ihr noch eine Geschichte vor. Obwohl sie damals noch nicht einmal vier Jahre alt war, kann sie sich gut daran erinnern, wie ihr die „Tante“ nach dem Weggang der Mutter sofort das Buch wegnahm und sie, nachdem die Tränen nicht versiegen wollten, schlug. Das war sozusagen ihre Lektion für das erwartete Verhalten im Heim: „Du darfst dich nicht wehren, du darfst nicht weinen, weil das zieht immer körperliche Gewalt nach sich.“