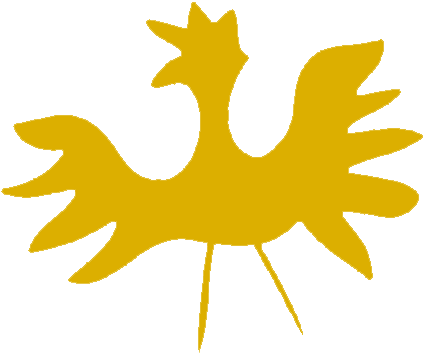Blog Erwin Aschenwald, ehemaliger Zögling Bubenburg Fügen
Aus: Gaismair-Jahrbuch 2010 (Interview mit Georg, anonymisiert, 6.5.2009)
Horst Schreiber
Schlagen, demütigen, missbrauchen
Eine Kindheit in der „Bubenburg“ zu Fügen
Eigentlich kann Georg trotz seiner grauenhaften Kindheit und Jugend sogar noch von Glück sprechen, dass er – altersbedingt – nicht schon in den Nachkriegjahren in die Anstalt eingewiesen wurde. Zu dieser Zeit wurden gerade die Hitlerbilder ab- und die Kreuze und Heiligenbilder wieder aufgehängt, um die „Zöglinge“, nun im Namen Gottes, so lange zu terrorisieren, bis sie wussten und fühlten, was die Hölle auf Erden war.
Die Anstalt – das ist das in einem Kloster untergebrachte Knabeninternat im Zentrum Fügens samt angeschlossener Sondererziehungsanstalt, die außerhalb dieser Gemäuer eines ehemaligen Schlosses lag. Diese Fürsorgeinstitution, zunächst Knabenheim St. Josef genannt, wurde 1926 vom Seraphischen Liebeswerk für Tirol und Vorarlberg des Kapuzinerordens gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt das Knabenheim unter der Leitung des Kapuzinerpaters Magnus Kerner seinen heutigen Namen „Bubenburg“.Wenn nun im Folgenden die Erfahrungen eines der „Zöglinge“ geschildert werden, so ist zu berücksichtigen, dass wir von den 1970er-Jahren sprechen, also von einer Zeit, in welcher der Höhepunkt autoritärer Erziehungspraktiken, auch in der „Bubenburg“, schon längst überschritten war.
Der Makel als Alleinerzieherin
„Herr unser Gott, wir danken dir für unsere Mutter. Es ist wichtig, daß Mutter bei uns bleibt und gesund ist. Amen.“ (Muttertagsgottesdienst)
Der Grund für die Einweisung Georgs in ein katholisches Heim ist repräsentativ für viele seiner LeidensgenossInnen. Der alleinerziehenden Mutter, die zeitweise auch mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte, wurde nicht zugetraut, ausreichend für das Kindeswohl sorgen zu können. Dabei spielte weniger die sorgfältige Prüfung der Lebensumstände der Ein-Eltern-Familie oder des Entwicklungsstandes des Buben eine Rolle, um sodann Maßnahmen zu treffen, welche Mutter und Kind stützen und fördern würden. Allein die Tatsache, eine Ledige mit Kind zu sein, führte zur automatischen Amtsvormundschaft, welche die Mutter geradezu entmündigte und die Fürsorgerin mit weitreichenden Entscheidungsbefugnissen ausstattete.
Die Mutter: Schneiderin wollte sie werden, sich ein eigenes Leben erarbeiten. „Du bist ein fesches Dirndl, wozu willst du einen Beruf lernen, wirst ja doch geheiratet. Das ist doch hinausgeschmissenes Geld“, bekommt sie zu hören. Ein Allerweltsschicksal, ein ganz „normales“ Frauenschicksal in der Tiroler Provinz, das seinen Lauf nimmt. Zum Unglück der Mutter sollte sich geradezu zwangsläufig das Unglück des Sohnes gesellen. Sie zieht in die Stadt, verliebt sich, wird geschwängert, der Mann nimmt seine Verantwortung nicht wahr und macht sich aus dem Staub. Die logische Konsequenz: Sie kehrt in ihren Heimatort zurück. Was gilt eine Frau ohne Mann in dieser Situation in der Tiroler Gesellschaft?
Zunächst halten sich die Folgen des „Fehltritts“, wie die Geburt eines unehelichen Kindes allgemein in ihrem Umfeld gesehen wird, noch einigermaßen in Grenzen. Die ersten paar Jahre leben die beiden bei Georgs Großmutter. Doch bald nach ihrem Tod beginnen die Schwierigkeiten. Die Mutter findet Arbeit bei einem Schneidermeister im Ort, nach kurzer Zeit stellt sich allerdings heraus, dass in Wirklichkeit eine tüchtige Ehefrau für dessen behinderten Bruder gesucht wird. Die Mutter weist dieses Unterfangen jedoch brüsk zurück. Nun schaltet sich die Schwester ein, die sich intensiv um den behinderten Bruder gekümmert hat, eine Schwester, die zugleich auch Ordensschwester und Gemeindekrankenschwester ist. Sie bemüht sich darum, dass die Kinder Gottes den rechten Weg finden und tritt daher im Ort als treibende Kraft bei der Einweisung von Buben und Mädchen in katholische Erziehungsheime auf. So können sich in Georgs Fall ihre persönlichen Privatinteressen, Rachegelüste und ihr missionarischer Eifer hinter hehren christlich-moralischen Wertmaßstäben verstecken.
Überstellung und Ankunftsschock
„Und wer in meinem Namen solch ein Kind annimmt, der nimmt mich an.“ (Mt 18,1-5)
Die Mutter verspricht dem Sohn hoch und heilig, ihn nie und nimmer in ein Heim zu stecken. Dass sie ihre Zusage nicht einhalten und dem Buben keinen mütterlichen Schutz angedeihen lassen konnte, verzeiht sie sich zeit ihres Lebens nicht. Die Selbstvorwürfe und Schuldgefühle werden sie bis zu ihrem Tod begleiten. Georg, der entsprechend seiner ländlichen Umwelt bereits früh selbstständig war, ein Umstand, welcher der Familie als Vernachlässigung ausgelegt wurde, muss sich erst mühsam mit den Heimregeln vertraut machen:
„Dann stehst da als Bua mit achteinhalb Jahren. Dann geht’s ab in die Bubenburg. Ich war es einfach gewohnt von Mama: Ich geh dort hin, zu Verwandten – bist da, wenn es dunkel ist. Ich konnte mich damals extrem frei bewegen. Plötzlich steh ich da, erstes Abendessen, und wie du es von daheim gewohnt bist, sagst du ‚mmhhh guat’ und kriegst dann schon als erstes eine von hinten auf die Schläfe getrommelt.“
Nach dem Essen, das in absolutem Stillschweigen zu verrichten ist, dürfen die Zöglinge aufs Klo gehen, aber nur Händchen haltend in Zweierreihe aufgestellt im Gänsemarsch, angeführt von einer Klosterfrau. Als Georg am nächsten Tag abermals wegen einer Nichtigkeit eine „betoniert“ bekommt, ist ihm eines klar: „Da bleibe ich nicht länger.“ Den größten Teil seiner rund 30 Kilometer langen Flucht nach Hause legt er zu Fuß zurück. Doch die Mutter ist nicht daheim. Kurz nach seiner Verfrachtung ins Heim wurde sie vom Einkaufen weg in das Psychiatrische Krankenhaus Hall zwangseingewiesen. Als er sie nach langer Zeit auf der „Geschlossenen“ erstmals besuchen darf, herrscht ihn die Ordensschwester, die für seine Unterbringung in der „Bubenburg“ gesorgt hatte und ihn nun begleitet, an: „Du singst jetzt deiner Mutter ein Lied.“ Das Grauen überfällt Georg noch heute, wenn er sich daran erinnert, wie die anderen Patientinnen bei seinem Anblick verzweifelt zu schreien beginnen: „Die darf ihren Sohn sehen. Die darf ihren Sohn sehen.“
Der erste Fluchtversuch ist zugleich Georgs letzter, da er mit ansieht, wie seine Kollegen immer wieder „eingefangen“ und zurückgebracht werden. Dadurch seien ihm zumindest im Gegensatz zu anderen die Schocktherapien samt verhängnisvoller Diagnostik der berüchtigten Leiterin der Kinderpsychiatrischen Beobachtungsstation in Innsbruck erspart geblieben. Maria Nowak-Vogl, die Leiterin, absolvierte nicht zufällig ihre medizinische Ausbildung größtenteils in der NS-Zeit.
Immerhin kann Georg bis nach den Weihnachtsferien bei den Verwandten bleiben, doch niemand erklärt sich bereit, den Buben langfristig aufzunehmen. Im Heim des Seraphischen Liebeswerkes wähnen sie ihn in besten Händen: „Du hast es doch gut bei den Patres, du kriegst dort ja alles, was du brauchst.“ Daraufhin wird Georg wieder nach Fügen „überstellt“, wie er betont. Immerhin behandelt man ihn einige Zeit zuvorkommend, „weil sie gemerkt haben, da schaut wer drauf. Doch das hat sich dann irgendwann einmal wieder aufgehört.“
Eine Orgie des Schlagens und Demütigens
„Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig.“ (Jak 2,10)
Um 6 Uhr 30 werden Georg und seine acht- bis zehnjährigen Leidensgenossen von der Ordensschwester Benjamina durch ein kräftiges Händeklatschen mit einem herzhaften Morgengruß – „Gelobt sei Jesus Christus“ – geweckt, um unisono mit „In Ewigkeit Amen“ zu antworten. Dann beginnt eine Prozedur, die sich nach dem Sprichwort „Wen Gott liebt, den züchtigt er.“ richtet und welche die Zöglinge bis zum Schlafengehen begleitet. Als erstes erfolgt eine Überprüfung der sogenannten „Schiffer“. Die Bettnässer stellen ein ausgesprochenes Feindbild dar. Jedes Bett wird examiniert, in jede Unterhose geschnüffelt. Die Entdeckung eines Missetäters hat den Einsatz der überlangen, spitzen Fingernägel der Barmherzigen Schwester zur Folge, mit denen sie ihren Schutzbefohlenen in die Ohren zwickt und sie an den Haaren zu sich heranzieht, um den „Lukas“ in Stellung zu bringen. Der Teppichklopfer kommt dann 15 bis 20 Mal in Anwendung, bis dem kleinen Sünder Hören und Sehen vergeht. Nägelbeißer haben es gut, bei ihnen begnügt sich Benjamina mit Schlägen auf die ausgestreckten Handflächen. Um dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben, schneidet die Schwester den Knaben die Fingernägel derart kurz, dass es schmerzt. Das eine oder andere Mal kann es schon passieren, dass sie den Finger statt des Nagels erwischt. Wie es sich gehört, müssen die Zöglinge darum bitten, die Nägel geschnitten zu bekommen, und anschließend ihrer Peinigerin auch Dank abstatten.
Denunziation und Maßnahmen zur Entsolidarisierung erfreuen sich in der christlichen Erziehungspraxis in Fügen außerordentlicher Beliebtheit. Zum einen hat dies seit der Gegenreformation gerade im heiligen Land Tirol eine jahrhundertelange Tradition, zum anderen kann auf den Erfahrungsschatz des Nationalsozialismus zurückgegriffen werden. Regelmäßig ernennen die Schwestern einen „Kapo“, dessen Aufgabe als Vertrauensperson der Obrigkeit es ist, Übeltäter zu nennen, die gegen eine der schier endlosen Zahl an einzuhaltenden Normen verstoßen haben. So erhält der „Kapo“ als Betätigungsfeld die Überprüfung der Buben-Unterhosen auf Urinspuren und „Materialfürze“. Nach erfolgter Entdeckung pflegt Schwester Benjamina den Acht- bis Zehnjährigen die beschmutzte Unterhose zusammengeknüllt in den Mund zu stecken. Neben der unermüdlichen Überwachung etwaiger geschlechtlicher Handlungen stellt das Wühlen in zu beforschenden Exkrementen eine der großen Obsessionen der Autoritäten im katholischen Heim dar. Die Buben dürfen sich in ihrem Gewissenszwiespalt entscheiden, ob sie den Kameraden und Freund verpetzen oder selbst Gefahr laufen wollen, strenge Strafen wegen unterlassener Denunziation auszufassen. Die Belohnung des „Kapos“ besteht darin, dass er in der Zeit der Auserwähltheit als „Mantschgerl“ gilt, dem von der Klosterschwester „übers Gsichterl und Kopferl“ gestreichelt wird: „Da hast du dann gewusst, das Mantschgerl kriegt heute keine auf die Nuss, aber wenn Mantschgerl nicht folgt oder gar selbst ins Bett schifft, dann gibt’s den Lukas.“ In der „Bubenburg“ war aber nicht einmal auf Heilige Verlass. Dass viele Burschen trotz der Züchtigungen und Erniedrigungen Bettnässer blieben, erstaunte die Dienerinnen Gottes umso mehr, als jeden Abend der Heilige St. Veit in einer nicht enden wollenden Litanei angerufen wurde: „Heiliger St. Veit, weck mi bei Zeit. Nit z’früah und nit z’spat, dass nix ins Bett gaht.“
Doch nicht nur die Klosterschwestern blieben Georg mit Ausnahme der „ganz lieben alten Schwester Beatrix“ in unschöner Erinnerung, auch an die Kapuzinerpater denkt er mit Verbitterung. Der Pater Direktor, auch Pater Magnus genannt, zeichnete sich durch seine Begeisterung für Wehrhaftigkeit, seine Kriegsteilnahme im reichsdeutschen Heer, seinen Antisemitismus und seine ausgeprägte Homophobie aus. Doch war er nicht nur ein Mann des Wortes, sondern auch der Tat. Kraft seines voluminösen Körpers verstand er es, seinen Argumenten mit den ihm von Gott gegebenen nimmermüden Fäusten Nachdruck zu verleihen. Seine unflätige Ausdrucksweise entsprach zwar nicht gerade klösterlicher Selbstdisziplinierung, die einschüchternde Wirkung blieb jedenfalls bei den Buben nicht aus. Dementsprechende Anekdoten, die seinen erstaunlich variantenreichen Wortschatz an Beschimpfungen bezeugen, sind so zahlreich überliefert, dass wir uns an dieser Stelle mit wenigen, dafür repräsentativen Skizzen begnügen müssen. Während Pater Magnus mit seinen hart erkämpften NS-Militärorden und seiner Kriegsverletzung aus dem Zweiten Weltkrieg prahlte, bezeichnete er Absolventen der „Bubenburg“, die ihrer Männlichkeit durch die Ableistung des Zivildienstes Abbruch getan hatten, schlicht als „feige Schweine“. Immerhin wusste er die Insassen des Heimes von seinen Führungsqualitäten, die er laut eigener Angabe während des Krieges unter Beweis gestellt hatte, hinreichend zu überzeugen. In der Tat scheint für ihn die Zeit in der Wehrmacht jene Schule des Lebens gewesen zu sein, die ihn besonders dazu befähigte, mit seinen nun minderjährigen Untergebenen „fertig zu werden“, wie Pater Direktor nicht zu betonen vergaß. Beim kleinsten Verstoß konnte der Choleriker ohne Rücksicht auf Verluste zuschlagen. Eine Gruppe 12- bis 14-Jähriger, die ihre Zelte im Sommerlager der „Bubenburg“ eine Nacht vor der Abreise frühzeitig abbauten, um am nächsten Morgen rasch startklar zu sein und deshalb zu zweit im selben Bett übernachteten, ließen den Kapuzinerpater vollends die Contenance verlieren. Seine Bergpredigt wich vom ursprünglichen Vorbild krass ab: „Da steht der Pater Magnus mit diesen leichten Schaumrändern um den Mund und schreit nur und immer wieder: ‚Ihr warmen Brüder. Ihr warmen Brüder. Ihr warmen Brüder.’“ Daraufhin müssen die Burschen Schischuhe und kurze Hosen anziehen – ein Demütigungsritual, das ansonsten in der warmen Jahreszeit angesichts vorüberziehender Mädchen der Hauptschule Fügen zur Anwendung kam, während die Jugendlichen gezwungen wurden, sich an den Händen zu halten. Mit einem Rucksack voll mit Steinen bepackt heißt es nun bis zur Erschöpfung Runden drehen, während Pater Direktor im Falle des Zusammenbruchs eines Burschen seine militärerprobte Stimme wortgewaltig zum Himmel erhebt: „Schneller, ihr warmen Brüder. Macht weiter, ihr warmen Brüder. Hilf deinem warmen Bruder.“
Die Verabreichung von Hieben war denn auch generell eine der beliebtesten Erziehungsmethoden. Verweigerte ein Bub das Verspeisen angeschimmelten Brotes, lachte er beim Essen, schlug er falsche Töne beim „freiwilligen“ Musizieren an oder betete er zu leise, so konnte er für derartige Nichtigkeiten „neben ein paar Ohrfeigen auszufassen schon einmal gewürgt oder unter den Tisch getreten werden.“
Die Anstellung völlig überforderter ErzieherInnen ohne Ausbildung war in den Tiroler Heimen bis in die jüngste Vergangenheit die Regel. Ehemalige (?) Nazis, Alkoholiker, Sadisten, Pädophile und Gestrauchelte aller Art konnten jahrzehntelang in der Abgeschiedenheit der geistlichen und weltlichen Mauern der Tiroler Fürsorgeanstalten ihr Unwesen treiben und ihre psychischen Deformationen an Minderjährigen aus sozial unterprivilegierten Schichten ausleben, die ihres besonderen Schutzes bedurft hätten. Behörden, Politik und Kirchenleitung sahen weg und nahmen ihre Aufsichtspflicht nicht wahr, sofern die Zustände überhaupt dem eigenen Erziehungsverständnis widersprachen. Pater Magnus’ Personalpolitik sorgte jedenfalls dafür, dass der „Bubenburg“ auch aus den Reihen der weltlichen Erzieher die Schläger und sexuell Perversen nicht ausgingen.
Da gab es den dickleibigen, abgehalfterten ehemaligen Stewart, dessen Trunksucht kein Hindernis darstellte, in der „Bubenburg“ unterzukommen, wo seine kräftige Handschrift gefragt war. Wer eine seiner Anweisungen missachtete, holte sich im wahrsten Sinne des Wortes eine blutige Nase. In seiner Nähe sehnten sich die Burschen geradezu danach, nur an den Haaren gezogen und mit dem „Lukas“ traktiert zu werden.
Dass aber Prügelpädagogen nicht als das Schlimmste erlebt werden mussten, zeigte sich am Beispiel eines anderen systemkonformen Erziehers, der zunächst einen frischen Wind ins Heim brachte, indem er erlebnispädagogische Elemente einführte und für die Abschaffung des Badehosenzwangs beim Duschen sorgte. Doch bald sollte sich der eigentliche Grund seines pädagogischen Eros herausstellen. Er suchte sich jeweils zwei Burschen aus, die abgesondert von den anderen ihr Geschlecht entsprechend seinen peniblen Anweisungen zu waschen hatten. Zudem präsentierte er sich als Sportmasseur, dessen Hände dorthin wanderten, wo sie fehl am Platze waren. Es dauerte aber nicht lange, bis auch er auf bewährte Erziehungsmuster der „Bubenburg“ zurückgriff: schlagen, demütigen, Denunziationen fördern. Aus dem ansonsten so ruhigen und zurückhaltenden Georg bricht es an dieser Stelle des Gesprächs plötzlich heraus: „Mag schon sein, dass Kritik aufkommt an meiner als ‚einseitig’ empfundenen Sicht der Dinge. Aber soll ich diesem Arschloch dankbar sein dafür, dass ich ohne seine ‚Hilfe’ als Ewachsener möglicherweise nicht imstande wäre, mir den Zipfel zu waschen?“
Widersetzlichkeiten und Überlebenstechniken
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehest unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“ (Mt 8,8)
Georg entwickelt einen Selbstschutzmechanismus innerhalb der Gefängnismauern der „Bubenburg“. Dies war auch notwendig, wie er zu berichten weiß: „Was mich lange belastet hat, ist das Ausgeliefertsein und die Gewalt.“ Um das zehnte Lebensjahr quälen ihn auch Selbstmordgedanken. Doch er findet einen Rückzugsort: Die Schule und die Bibliothek, zu der er sich durch das Entwenden des Schlüssels unbegrenzten Zugang verschafft. Immer wenn er verzweifelt ist oder einen Ort der Ruhe benötigt, flüchtet er in die Welt des Geistes, die ihm Trost spendet, einen Schutzraum jenseits der klösterlichen Brutalität bietet und seine kindliche Neugier stillt. Er liest wahllos alles, was ihm in die Hände fällt. Georg glaubt nicht, dass dies noch normal war, und trotzdem hat ihm das Lesen wenn nicht das Leben gerettet, so doch es halbwegs erträglich gemacht. Die Schule fällt ihm leicht, den größten Teil des Unterrichts in Deutsch verbringt er in der Bibliothek, in die er geschickt wird, weil der Lehrer den Begabten in der Klasse nicht zu fördern versteht.
Eine der symptomatischen Diskriminierungen in den Tiroler Erziehungsheimen stellt die Vernachlässigung der Aus-Bildung der Zöglinge dar. Ziel der Beschulung war nicht, die benachteiligten Kinder aus bildungsfernen Schichten zu stützen, um ihre Bildungsbenachteiligung wettzumachen. In ihnen wurden die künftigen billigen Hilfsarbeiter in Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie gesehen, nicht die Herren, sondern die Knechte. Dementsprechend war es logisch, dass die Insassen der „Bubenburg“ nicht die öffentliche Hauptschule von Fügen und schon gar nicht eine Höhere Schule besuchten, sondern eine achtklassige Volksschule, die als Sondererziehungsanstalt definiert war. Wer wenigstens ein Abschlusszeugnis des B-Zugs erhalten wollte, wie der zweite Klassenzug genannt wurde, mit dem man am Arbeitsmarkt dennoch stigmatisiert war, musste an der Fügener Hauptschule eine Externistenprüfung ablegen. Der Erwerb des Englischen blieb den Buben generell verwehrt. Dank der Eigeninitiative eines fortschrittlichen Erziehers, der das Heim aber bald wieder verließ, konnte sich Georg in wenigen Monaten wenigstens einige Grundkenntnisse aneignen.
Eine weitere Form der Überlebensarbeit bestand darin, dass einige Jugendliche versuchten, durch Aufmüpfigkeit und herausforderndes Benehmen die Opferrolle hinter sich zu lassen. „Kinder-KZ“, „Nazi-Pater“, „Heil Magnus“ und ähnliche Parolen schmiert Georg aus Wut, Trotz und Verzweiflung über das Eingesperrt- und Ausgeliefertsein auf die Mauern des zur „Bubenburg“ umfunktionierten ehemaligen Schlosses. Trotz finsterer Ermittlungsmethoden kann er nicht als Urheber ausgeforscht werden.
Einen der Schlägerpädagogen provoziert Georg bis auf das Blut. Er zeigt demonstrativ sein Desinteresse und seine Langeweile gegenüber dessen Anordnungen und unterdrückt nach außen jegliche Furcht. Als er wie so oft eine Ohrfeige verpasst bekommt, zuckt Georg nicht mit den Wimpern und verdirbt seinem Quälgeist die Genugtuung. Auch härteres Zuschlagen ruft bei ihm nicht die erwünschte sichtbare Reaktion des Schmerzes und der Unterordnung hervor. Auch wenn es Georg schwer fällt, nicht loszubrüllen. Eines Tages wagt er es, sich verbal aufzulehnen: „Super, jetzt haben sie gerade einen 13-Jährigen geschlagen der sich nicht wehren kann. Super, sie sind echt super.“ Die Kameraden toben vor Lachen, das Gejohle lässt sich nicht unterdrücken. In der Folge holt sich der Erzieher Georg regelmäßig aus der Gruppe, um ihm abgesondert von den anderen zwar Intelligenz, aber eine ausgesprochene Neigung zur Hinterfotzigkeit zu attestieren. Daraufhin prasselt eine Kanonade von Ohrfeigen auf ihn herab. Dies zieht sich über Wochen, doch Georg bleibt stur und trägt trotz brennender Backen den Sieg, das heißt Stolz und Würde, davon.
Die Langzeitfolgen katholischer Heimerziehung
„Freiheit ohne feste Bindungen und Selbstbescheidung, besonders ohne Gottesbezug wird tödlich.“ (Bischof von Fulda 2008)
Nach Beendigung der achtjährigen Volksschule mit anschließender Externistenprüfung zur Erlangung des Abschlusses eines Hauptschulzeugnisses mit dem Vermerk des Zweiten Klassenzuges hat Georg Glück im Unglück. Ihm wird vom Arbeitsamt handwerkliche Ungeschicklichkeit, aber schulische Lernfähigkeit bescheinigt. Er kommt in eine der „Bubenburg“ angeschlossene Wohngemeinschaft in Innsbruck, die Prügeleien haben ein Ende und er erfreut sich eines kleinen Stückchens Freiheit. Doch statt die Villa Blanca besuchen zu dürfen, die laut Jugendamt zu teuer ist, zu lange dauert und nicht seiner Herkunft entspricht, muss er in die Handelsschule eintreten. Dort wird ihm zu verstehen gegeben, dass er als einziger der SchülerInnen Absolvent einer „Deppenschule“ ist und seine Vorbildung alles andere als Erfolg versprechend sei. Georg verweigert sich daraufhin und widmet sich lieber der Produktion einer Schülerzeitung. Nach dem Abbruch der Handelsschule muss er die Wohngemeinschaft verlassen und ist sich selbst überlassen. Eine Starthilfe für eine eigene Haushaltsgründung gibt es nicht. Die nächsten 15 Jahre ist er damit beschäftigt, mehr schlecht als recht seine Existenz zu sichern, sich vor dem totalen Abstieg zu bewahren. Die Berufslaufbahn, die ihm vorschwebt, kann er nicht einschlagen, doch immerhin, ab dem 30. Lebensjahr, geht es langsam aufwärts. Rückblickend stellt Georg jedoch fest: „Um kein Geld zu haben, hätte ich damals nicht so viel buckeln müssen.“
Er ist sich aber im Klaren darüber, wie schmal der Grat für die Abgänger der „Bubenburg“ zwischen „Sein und Nichtsein“ war. Allzu viele der Kameraden haben es nicht geschafft, begingen Selbstmord, leiden immer noch unter großen psychischen Problemen, Alkoholismus und Drogenmissbrauch, gingen auf den Jungenstrich, wurden gewalttätig oder kamen sonst wie in Konflikt mit dem Strafgesetz. „Wenn er nicht wie ein Stück Scheiße behandelt worden wäre, vielleicht wäre dann …“, sinniert Georg über das triste Schicksal ehemaliger Kollegen.
Dass er selbst schlussendlich sein Leben auf die Reihe bekommen hat, führt Georg darauf zurück, dass er durch die Aufnahme in die Wohngemeinschaft mehr Halt und Reifezeit zur Verfügung hatte. Eine spezielle Rolle dürfte hierbei auch das Verhältnis zur Mutter gespielt haben, um die er sich kümmerte, der er unaufhörlich signalisieren musste, dass sie, die sich so schuldig fühlte und sich in immer wiederkehrender Folge aus schlechtem Gewissen gegenüber dem Sohn die Augen ausweinte, für die Geschehnisse nichts kann. „Das sagst du nur, weil du so anständig bist, aber insgeheim tust du mich verachten.“ – „Aber nein Mama, sicher nicht.“
Die Nachwirkungen der subtilen Gewalt und des Psychoterrors, dem Georg ausgesetzt war, machen ihm noch als Erwachsenen lange zu schaffen: „Ohrfeigen, okay, das hört irgendwie auf, das andere nicht, das hat eine andere Qualität.“ Georg erzählt von einem Kollegen in wohlgeordneten Verhältnissen, den es dennoch regelmäßig „flasht“, den also die bitteren Erlebnisse in der „Bubenburg“ in periodischen Abständen verfolgen. Er leidet dann unter Schlafstörungen und Albträumen, wird von Weinkrämpfen geschüttelt und kann sich nur durch übermäßigen Alkoholgenuss über diese Phase hinwegretten.
Die Zeit in der „Bubenburg“ glaubt Georg so einigermaßen bewältigt zu haben. Erinnerungen quälen ihn nur mehr, wenn er durch äußere Umstände, wie bei diesem Gespräch, wieder mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Er hat sich beruflich etabliert, die Berufsreifeprüfung absolviert und sich trotz der Bildungsvorenthaltung in seiner Kindheit und Jugend selbst beweisen können. Nun steht Georg vor dem Abschluss eines Studiums:
„Wenn es gut gelaufen ist, habe ich Schwierigkeiten gehabt, mir auch nur den geringsten Erfolg selbst zuzugestehen. Ich habe aber auch die Tendenz gehabt, statt den Sack zuzumachen, es mir zu vergeigen. Doch wenn Innsbrucker Bürgersöhne sagen, was hast du erreicht, bist ein Looser, dann muss ich sagen, jede einzelne Chance, die ich vergeigt habe, habe ich mir selber erarbeitet und ich bin niemandem auf der Tasche gelegen und das ist ja auch schon etwas.“
Georg verspürt eine Genugtuung, da er zeigen konnte, dass es sich bei den Zöglingen der „Bubenburg“ nicht um Kranke, Verbrecher, Minderwertige und Erbgutgeschädigte handelt, wie ihnen oft genug eingebleut wurde. „Eure Eltern, so ihr welche habt, sind gar nicht in der Lage, aus euch anständige Menschen zu machen.“ An solche Sätze erinnert er sich, solche Sätze und Bilder, die sie auslösen, versetzen ihn immer noch in ungeheure Wut. Deshalb will Georg aufklären und berichten, was damals geschah, damit Kindern künftig seine Erfahrungen erspart bleiben und sie nicht mehr in „Batteriehaltung verwahrt werden.“ So sieht er sich mehr als Zeuge, denn als Opfer. Seiner Tochter hat Georg über seine Kindheit und Jugend im Seraphischen Liebeswerk erzählt. Auf meine Frage, wie sie denn reagiert habe, erzählt er: „Mei zaach, mei krass Papa.“ Daraufhin habe er ihr entgegnet: „Jetzt weißt wenigstens, warum ich dich nie geschlagen habe.“