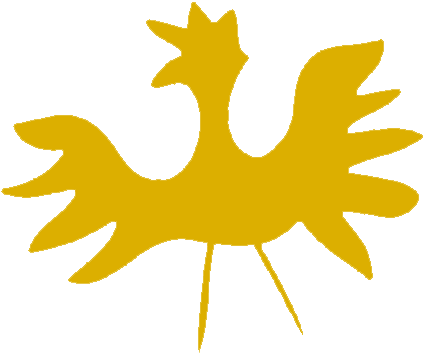Bericht von Brigitte Wanker über ihre Erfahrungen in der Arbeit im St-Josefs-Institut in Mils 1980
Aus: Horst Schreiber, Im Namen der Ordnung
St.-Josefs-Institut in Mils, 1980: „Ich erlebe andauernd, wie diesen Menschen der Weg zur Selbständigkeit versperrt wird.“
An der Jahreswende 1979/80 trat Brigitte Wanker im Alter von 22 Jahren eine Hilfspflegerinnenstelle im Pflegeheim des von den Barmherzigen Schwestern geführten St.-Josefs-Institut in Mils an. Die offizielle Bezeichnung des Hauses lautete „Pflegeanstalt für Geistesschwache“. So wie die Klosterschwestern und sonstigen Angestellten verfügte auch Wanker über keine Fachausbildung. Sie war eigentlich gelernte Weberin und mit der Absicht angetreten, ihre handwerklichen Fähigkeiten zu nutzen, um die Kreativität der Kinder zu fördern. Am Institut waren zu diesem Zeitpunkt 210 Personen aller Altersstufen untergebracht, von Kleinkindern bis zu alten Menschen. Rund ein Drittel waren Kinder, die über das Jugendamt oder von ihren Angehörigen eingewiesen wurden. Alle Insassen wurden als „geistig Schwerstbehinderte“ geführt, obwohl die Gruppen sehr heterogen zusammengesetzt waren. In ihnen befanden sich auch Menschen, die nur eine körperliche Beeinträchtigung hatten oder Hospitalisierungserscheinungen aufgrund mangelnder Zuwendung und Förderung zeigten. Viele Kinder und Jugendliche im St.-Josefs-Institut kamen aus schwierigen Familienverhältnissen und hatten bereits längere Heimkarrieren hinter sich. Es handelte sich oft um Heranwachsende, die abgeschoben worden waren, die Schwestern kümmerten sich um Menschen, die kaum jemand wollte, mit denen man sich im Heimatdorf vor den NachbarInnen schämte und die zeitaufwändig zu betreuen und zu fördern waren. (...)
In den Genuss von konsequenten und zielgerichteten Therapien kamen die wenigsten. Das Programm bestand aus Arbeit in der klösterlichen Landwirtschaft, in der Küche etc. Für einige gab es dafür ein Taschengeld, über das aber nicht selbstmächtig bestimmt werden konnte. Der Heimalltag, den Brigitte Wanker kennenlernte, war bis ins Detail vorgeplant und in ein enges zeitliches Korsett gepresst. Dies übte Druck auf die Betreuerinnen aus, der Pflege und den Tätigkeiten Vorrang einzuräumen, die den reibungslosen Ablauf des Anstaltsbetriebs garantierten. Der unverantwortbar schlechte Betreuungsschlüssel verhinderte eine individuelle Förderung, ein liebevolles, respektvolles Verhältnis und einen kindgerechten Umgang. Brigitte Wanker hatte für 24 schulpflichtige Buben Sorge zu tragen. Bestimmte bereits die starre, menschenunfreundliche Binnenorganisation über Betreuerinnen und Betreute, kamen noch die mangelhafte Ausstattung, die Überforderung des Personals durch Unterqualifikation und der Geist der klösterlichen Härte hinzu.
Brigitte Wanker war in ihrem jugendlichen Idealismus von der Strenge und Gefühllosigkeit schockiert, die an diesem Ort Arbeit und Alltagsroutine begleitete. (...) Sie hörte die Schwestern und die Mutter Oberin von „harter Liebe“ und „Zucht und Ordnung“ reden und sah sie danach auch handeln. (...) Zärtlichkeitswünsche der Kinder galten als Unbotmäßigkeit, Störung des Anstaltsbetriebes und als Gerissenheit, weil das schmeichelnde Kind auf diese Weise seinen Vorteil suche und eine Bevorzugung gegenüber den anderen. Die Buben wurden misshandelt, erniedrigt, ihrer Würde beraubt und zu unselbstständigen „Deppen“ erzogen. Resultat war, dass sie, sofern es ihnen möglich war, ihrerseits die anderen Kinder schlugen oder nach dem Vorbild der Schwestern schimpften. Mehrmals täglich wurden sie in Zweierreihen frisiert, adjustiert und im Rudel aufs Klo geführt. Bei geringen Vergehen wie dem Stolpern über ein Kabel, das dadurch herausgerissen wurde, setzte es sofort Schläge. Wer den Teller nicht leerte, wurde unter die kalte Brause gestellt oder so lange abgeduscht, bis der letzte mit Erbrochenem vermengte Rest des Essens hinuntergewürgt war. Widerstand musste gebrochen, die Willigkeit zur Einordnung und Anpassung schlagkräftig gefördert werden. Lehnte sich ein Bub auf oder zerstörte er etwas mit oder ohne Absicht, wurde er, sofern Duschen und Schläge ins Gesicht unzweckmäßig erschienen, in eine Zwangsjacke gesteckt. Sie konnte auch zur Arbeitserleichterung genutzt werden, wenn allzu viele Kinder in den großen Gruppen gleichzeitig zu versorgen waren. Für Abwechslung sorgten Spaziergänge, natürlich in Zweierreihen, auf den immergleichen ausgetrampelten Pfaden dieser kleinen, von der Umgebung abgeschotteten Welt, die sich selbst genügte. Zum Spielen oder für die Hausaufgabenbetreuung musste Brigitte Wanker die 24 Buben in einem einzigen Raum beschäftigen. Spielsachen waren rar, der Lärm und die Langeweile groß. Sie versuchte mit Theaterspielen und Basteln ein klein wenig entgegen- zuwirken. Zeitweise, insbesondere aber wenn es regnete und kein Spaziergang durchgeführt werden konnte, musste Wankers Gruppe auf den neun Meter langen und zwei Meter breiten vergitterten Balkon. In diesem „Drahtverhau“ oder „Balkonkäfig“ verbrachten die 24 Buben zwei Stunden. Einige von ihnen waren solch beengte Verhältnisse schon gewohnt; denn sie lagen oft – aus welchen Gründen immer – angegurtet in ihren Betten.
Brigitte Wanker führte ein Tagebuch, darin notierte sie:
„Hilflose Kinder, Jugendliche und Alte werden da drinnen aufbewahrt, gepflegt und bevormundet, und ich bilde mir immer noch ein, etwas verändern zu können. Werde auch ich bald abstumpfen? (...) Ich erlebe andauernd, wie diesen Menschen der Weg zur Selbständigkeit versperrt wird. Jeder wird gleich behandelt, ohne Rücksicht auf vorhandene Fähigkeiten, Eigenheiten und Bedürfnisse. Nichts kann selbst bestimmt werden, der tägliche, hektische Tagesablauf, festgelegte Zeiten, Mauern, Gitter, kaum ein Aufmucken – die Kinder haben sich daran gewöhnt, nehmen alles hin, ein Aus- brechen wäre sinnlos.“
Im St.-Josefs-Institut gab es keine Teambesprechungen und auch keine Supervision. Der Reflexion des Erziehungsgeschehens wurde kein Platz ein- geräumt. Von Tag zu Tag mussten sich die Schwestern und Brigitte Wanker durchschlagen und unhinterfragt die Tradition des Hauses weiterführen. Die Überforderung war kein Thema. Investitionen in eine Ausbildung sowieso nicht. Die junge Frau fühlte sich ausgeliefert, macht- und hilflos, mitschuldig, all dies ansehen zu müssen und nichts dagegen tun zu können. Ihr Entsetzen teilte sie mit der einen oder anderen Angestellten. Sich mit der Heimleitung anlegen und den Arbeitsplatz gefährden, wollte niemand. Brigitte Wanker kontaktierte ihre Vorgängerin, die ebenfalls längst etwas gegen die untragbaren Zustände im Heim unternehmen wollte. Die Kollegin erzählte ihr, dass sie bereits mit einer Fürsorgerin des Jugendamtes darüber gesprochen hatte, dass diese jedoch keine Möglichkeit sah, einzugreifen. (...)
Brigitte Wanker gab aber nicht auf und begab sich zum Leiter des Innsbrucker Jugendamtes Hermann Schweizer: „Ich ging da sehr stolz und selbstbewusst hin und erwartete mir wirklich eine Unterstützung und ich sagte, ich bin da, weil ich Aufzeichnungen mithabe und zutiefst erschüttert bin, was ich da erleben musste. Da habe ich an seinem Blick erkannt, dass er nicht sehr erfreut war und zuerst hat er mir ganz väterlich auf die Schulter geklopft und gesagt, sie sind viel zu sensibel für diese schwierige Arbeit. Dann hat er mich angeschrien, verbrennen Sie sofort Ihre Aufzeichnungen, hören Sie sofort auf weiterzuschreiben. Sind wir doch froh, dass es noch Schwestern gibt, die sich für diese Menschen aufopfern. Es war kein gescheites Gespräch mehr möglich, weil ich habe dann meine Sachen zusammengepackt und bin rausgegangen. Ich bin so erschrocken, ich bin geflüchtet.
Daraufhin kündigte Brigitte Wanker schweren Herzens, die Buben gaben sich mehrheitlich tief betroffen („Magst uns nimmer?“): „Ich habe versucht, gegen mein Ausgeliefertsein in diesem festgefahrenen, unmenschlichen System anzukämpfen. Immer wieder mußte ich feststellen, daß es für mich überhaupt keine Möglichkeit gab, etwas zu verändern.“
Mit der Hilfe des Erziehungswissenschafters Volker Schönwiese konnten sie und ihre Vorgängerin mit Kurt Langbein und Claus Gatterer in Verbindung treten, die damals das kritische Fernsehmagazin „teleobjektiv“ betreuten und jene Sendung über Heime vorbereiteten, von der schon mehrfach in dieser Studie die Rede war. Auch über das St.-Josefs-Institut in Mils wurde 1980 unter Mitwirkung der beiden jungen Frauen ein Beitrag ausgestrahlt. Über die Reaktion in der Öffentlichkeit berichtet Max Wanker: „Mit meinem Wissen über das Leben der Kinder im St.-Josefs-Institut schien mir die Reportage in ‚Teleobjektiv‘ geradezu zurückhaltend, aber doch deutlich genug, um die Kirche und zuständigen Behörden zu alarmieren und zum Eingreifen zu bewegen. Ein naiver Glaube, wie sich bald herausstellte. Die Reaktionen auf die Ausstrahlung im Fernsehen übertrafen meine schlimmsten Erwartungen. Es hatte den Anschein, als fühlten sich Politiker, Kirchenvertreter und selbst die sich als unabhängig bezeichnende Tiroler Presse mehr der Parteinahme für die sich als aufopfernd bezeichnenden geistlichen Schwestern verpflichtet als dem Schutz ihrer Opfer, den betroffenen Kindern und Jugendlichen. Das ‚Heilige Land‘ Tirol war im Aufruhr und binnen kürzester Zeit war eine geschlossene Front gegen die Redakteure von ‚Teleobjektiv‘, gegen meine Tochter und ihre Mitstreiterin entstanden, die als ‚Nestbeschmutzerinnen‘ diffamiert wurden. (...) Viele Leserbriefe, die mir vor dem Absenden von Freunden und Bekannten vorgelegt wurden, kamen nie zur Veröffentlichung. (...).“ (...)
Die „Tiroler Tageszeitung“ berichtete, dass die Sendung „in weiten Bereichen Tirols einen Entrüstungssturm ausgelöst“ habe. Aufgrund der Art und Weise der Darstellung der Tätigkeit der Schwestern in Mils hätte sich Landeshauptmann-Stellvertreter Fritz Prior veranlasst gesehen, gegenüber ORF-Generalintendant Gerd Bacher im Namen des Landes Tirol „einen geharnischten Protest“ einzulegen. (...) Prior zitierte daraufhin auch die jungen Frauen zu sich und drohte ihnen massiv. Brigitte Wanker erinnert sich, dass sie sich „irrsinnig gefürchtet habe, weil er mir sagte, solange er lebe, werde er dafür sorgen, dass ich nie eine Landesstelle bekommen werde.“ Wanker verließ Priors Büro weinend. (...)
Durch die damals äußerst enge Verbindung zwischen Landespolitik und katholischer Kirchenführung war es möglich, einen derart großen Druck aufzubauen, dem sich schlussendlich auch die Medien weitgehend beugten. Die „Tiroler Tageszeitung“ stand Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre noch in einem Naheverhältnis zur ÖVP, die als dominante Partei auch einen wesentlichen Einfluss auf den Tiroler Rundfunk ausübte. Bernhard Praxmarer, Dekan von Hall und einer der angesehensten Kleriker Tirols, der bereits 1937 zum Priester geweiht worden war, wusste, wie man am besten mit KritikerInnen umgehen musste, um sie unglaubwürdig zu machen. „Der hat mich dann auch sehr beschimpft, dass ich ein Opfer des Kommunismus sei und des linken Packes, dass ich eine linke Emanze sei (...) und dass ich Geld bekommen hätte (...). Ich bin dann wutentbrannt raus“, so Brigitte Wanker. (...) Die Emotionen gingen derart hoch, dass Brigitte Wanker sogar Drohbriefe erhielt.
Für das St.-Josefs-Institut hatte es keine Konsequenzen, dass die beiden Frauen die Mauer des Schweigens durchbrochen hatten. Das gerichtliche Vorverfahren endete rasch mit einer Einstellung mangels an Beweisen. Bei den Vernehmungen bei der Staatsanwaltschaft und der Polizei fühlten sich die beiden ehemaligen Mitarbeiterinnen des Instituts wie die Angeklagten. Die Anstrengungen und Nachforschungen der Staatsanwaltschaft waren ohne Nachdruck. Brigitte Wanker verließ Tirol schließlich und ging nach Wien, wo sie sich zur Sozialpädagogin ausbilden ließ und in diesem Berufsfeld arbeitete. Erst zehn Jahre später kehrte sie wieder nach Tirol zurück. Ihre Kollegin konnte jahrelang nur im Rahmen befristeter Dienstverträge eine Arbeit finden. (...) An den beiden jungen Frauen wurde ein Exempel statuiert, das einschüchternd wirken sollte. (...)