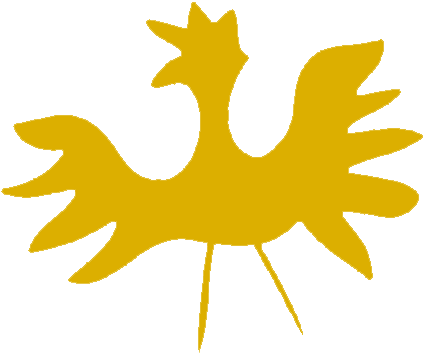Vom Sprechen und Nichtsprechen
Welche Gründe geben die ehemaligen Heimkinder für ihr bisheriges Schweigen an? Eine Schlüsselantwort darauf, mit der ausnahmslos alle übereinstimmen, gibt Julia Wegner: „Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mir niemand glauben wird.“ Während ihrer Heimzeit mussten alle InterviewpartnerInnen diese Erfahrung machen, die allermeisten auch danach. Das Wissen über die Geschehnisse war damals zwar vorhanden, doch sowohl bei den betroffenen Institutionen als auch in der Gesellschaft mangelte es an Interesse und Offenheit für ihre Heimkarrieren und Leidensgeschichten. Weder innerhalb noch außerhalb der Heime war eine unabhängige Beschwerdestelle eingerichtet. Die Befragten berichten, dass man sie oft genug einschüchterte, nur ja den Mund zu halten oder sie anwies zu lügen. Sie erzählen von LehrerInnen, ErzieherInnen, Fürsorgerinnen, Heimleitungen usw., welche die blauen Flecken wahrnahmen, aber wegsahen oder Erklärungen vertrauten, die gegen das Kind sprachen. Die wenigsten wollten sich gegen Vorgesetzte stellen, sich dem Vorwurf der Nestbeschmutzung aussetzen und gegenüber KollegInnen illoyal erscheinen. Die Loyalität gegenüber der Institution wurde unter Druck hergestellt. Denjenigen, die Missstände aufzeigten, wurde mit politischer Intervention gedroht. Die Angst um den Arbeitsplatz war nicht unberechtigt, karrierefördernd war ein Auftreten zugunsten der Kinder und ihrer Rechte allemal nicht. Es gab Besuche von Fürsorgerinnen und Abordnungen aus dem Jugendamt und der Politik in den Heimen. Diese Inspektionen, die der Kontrolle dienen hätten sollen, sahen oft so aus, wie Aloisia Wachter schildert: „Wir haben ein paar Lieder geträllert und dann sind die wieder gegangen. Dann war der gleiche Trott. Da ist nichts nach außen gedrungen, es wurde so dargestellt, wir sind eh gut gekleidet und es geht uns eh gut.“
Weitere Gründe für das jahrzehntelange Schweigen sind Scham und Schuldgefühle. Mehrere Interviewpartner wollten unbedingt vermeiden, dass an ihrem Arbeitsplatz oder unter FreundInnen und Bekannten ruchbar würde, dass sie ein Heimkind waren. Auch NachbarInnen, vor allem aber die eigene Familie sollte diese stigmatisierende Vergangenheit nicht kennen. Überdies wäre die Konsequenz des Redens gewesen, den innersten Kern der Persönlichkeit bloßlegen zu müssen. Zudem stelle sich die Frage, was das Reden bringen soll, da nichts mehr ungeschehen gemacht werden könne. Die Belastungen für Frau und Kind wären unzumutbar.
Es ist wenig verwunderlich, dass Männer in Anbetracht der gesellschaftlich vorherrschenden Männlichkeitskonstrukte ungleich mehr Schwierigkeiten und Abwehrhaltungen überwinden müssen, um über ihre Vergangenheit sprechen und ihren Opferstatus akzeptieren zu können, ohne sich darauf reduzieren lassen zu müssen. Dazu kommt, dass das Sprechen über einen sexuellen Missbrauch für Männer auch die Problematik der Infragestellung ihrer Männlichkeit beinhaltet. Der Zugriff des Missbrauchers droht sein Opfer zum Homosexuellen zu stempeln. Und: Homosexualität war strafbar. Die Interviews mit den ehemaligen Heimkindern und ihre Meldungen bei der Ombudsstelle des Landes Tirol und der Stadt Innsbruck decken sich mit dem wissenschaftlichen Befund, dass Mädchen stärker im familiären und Burschen mehr im institutionellen Umfeld Gefahr laufen, sexuellen Übergriffen ausgesetzt zu sein.
Wie erwähnt stellen Schuldgefühle ein wesentliches Moment dar, das Sprechen erschwert. „Und immer wieder habe ich die Schuld bei mir gesehen. Ich habe immer versucht, es allen recht zu machen. Und wo stehe ich heute?“, „Vielleicht bin ich als schlimmes, schlechtes Kind zu Recht nach Martinsbühel gekommen (…), man darf nicht sagen, ich war die Schuld, ich hätte etwas verhindern können.“ Diese oftmals von Frauen geäußerten Selbstinfragestellungen finden auch bei Männern durchaus eine Entsprechung. Walter Müller beschreibt, wie er sich nach seiner Einweisung nach Kleinvolderberg wegen kleinerer Diebstähle und auch in seinem späteren Leben gefühlt hat: „Das schlechte Gewissen, an diesem Zustand schuldig zu sein, versagt zu haben, das zu sein, wovor man eigentlich immer gewarnt wurde: ein Nichtsnutz, ein Versager. (…) Und die Schuldgefühle und das schlechte Gewissen wurden ja tagtäglich vergrößert und erweitert. Dafür sorgte eine Schar von Experten: die Erzieher.“ Aloisia Wachter führt noch ein weiteres Detail für das lange Schweigen an: „Gewalt und Züchtigung war für mich etwas ganz Normales. Deshalb habe ich nicht viel darüber geredet.“
Es kann durchaus Sinn machen, diese Kindheits- und Jugenderlebnisse als Selbstschutz zu verdrängen und darüber zu schweigen. Auf diese Weise ist es Heimkindern auch gelungen, ihr Leben einigermaßen auf die Reihe zu bekommen. Dazu Walter Müller: „Für mich war diese Zeit nicht existent. Ich habe da nicht gelebt, das hat es nicht gegeben, das war gar nicht ich.“
Viele wurden allerdings immer wieder von ihrer Vergangenheit eingeholt, bei ihnen funktionierte die Verdrängungsstrategie nicht. Die kollektive Aufdeckung der Misshandlungsvorfälle in den Heimen seit Frühjahr 2010 hat nun auch dazu geführt, dass verdrängte Erlebnisse der Kindheit und Jugend auf intensive Art und Weise plötzlich im Alltag wieder auftauchten. Viele Befragte sprechen in diesem Zusammenhang von höchst widersprüchlichen Empfindungen, von Schock und Befreiung, vom Zurückgeworfenwerden in die Vergangenheit, von Albträumen und Flashbacks, von Trauer und Schmerz, von Wut und Ohnmacht. Der Wunsch, als Mensch mit seinen Erlebnissen im Heim und dessen Auswirkungen verstanden zu werden, war für alle Befragten zentral und eine tiefe Sehnsucht. Denn damit in Zusammenhang stehen weitere Schlüsselbegriffe wie glauben, anerkennen, mitfühlen, ernst nehmen, respektieren, sich öffnen und offenbaren, Vertrauen schenken.
Was hat ehemalige Heimkinder nun dazu bewogen, nach so vielen Jahren ihre schrecklichen Erlebnisse einem Fremden mitzuteilen, sich bei der Ombudsstelle Tirol zu melden oder gar mit LeserInnenbriefen und Fernsehinterviews in die Öffentlichkeit zu gehen?
Roswitha Lechner, Karlheinz L. oder Georg A. geben an, dass sie stellvertretend für ihre verstorbenen Geschwister und all jene sprechen wollen, die dies nicht (mehr) tun können. Viele unterstreichen, dass sie Zeugnis ablegen möchten und aufklären, damit Kindern künftig die Erfahrungen erspart bleiben, die sie selbst machen mussten, damit Kinder nicht mehr „in Batteriehaltung verwahrt werden“, damit sich etwas in der Zukunft für die Kinder im Sinne von mehr Menschlichkeit und Wärme verändert, damit arme Frauen und Kinder nicht mehr im Stich gelassen werden, damit sich eine Bewusstseinsveränderung in der Behandlung von Kindern einstellt, damit Kinderschändern das Handwerk gelegt wird, damit alle wissen, was passiert ist und dass es passiert ist, damit den ehemaligen Heimkindern endlich geglaubt wird und ihre Leiden Anerkennung finden, damit die Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden, damit sie die Frage klären können, warum sie im Heim waren und so behandelt wurden, damit sie erfahren, was und wo ihre Wurzeln sind, damit sie die Zusammenhänge erkennen können, damit sie nun endlich die Aufarbeitung der eigenen Geschichte beginnen oder intensiver fortsetzen können, damit sie Ruhe und einen inneren Frieden finden, damit sie trauern können, damit die Verantwortlichen oder ihre NachfolgerInnen sich entschuldigen und – seltener – damit materielle Wiedergutmachungen erfolgen.
Es ist offensichtlich, dass ehemals diskriminierte und traumatisierte Menschen lange Zeit benötigen und bestimmte Rahmenbedingungen vorfinden müssen, um die Kraft zum Sprechen aufzubringen. Oftmals ist es nötig, ein gewisses Lebensalter erreicht zu haben, um das Wagnis einzugehen, sich der Öffentlichkeit, der Familie, dem Freundes- und Bekanntenkreis zu stellen – und damit auch sich selbst und den eigenen Beschädigungen, die aus der Heimzeit und der Kindheit resultieren. Übereinstimmend erklären die meisten der Befragten, dass die Medienberichte, die darin agierenden Personen und Betroffene, die sich in die Öffentlichkeit trauten, eine entscheidende Rolle für ihr eigenes Sprechen gespielt haben. Dies machte Mut und schuf Vertrauen, dass nun endlich den Aussagen der Heimkinder Glauben geschenkt wird. Auch wenn das Sprechen und sich wieder Erinnern wollen oder müssen für viele InterviewpartnerInnen mehr als anstrengend und belastend war, stellte dies auch einen Akt der Befreiung dar, war es überaus wohltuend, in den eigenen Schuldgefühlen entlastet zu werden. Niemand bereute die Entscheidung. Dazu Roswitha Lechner: „Und jetzt halte ich meinen Mund nicht mehr, habe ich gesagt. Ich halte meinen Mund nicht mehr. Da ist das losgegangen wie eine Lawine. Und jetzt wird geredet.“