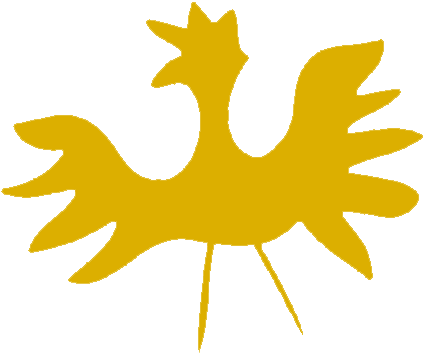Aus: Gaismair-Jahrbuch 2007
Horst Schreiber
Eine jenische Kindheit in Tirol
Die Jenischen, die stets in großer Armut lebten und in Tirol abschätzig auch „Karrner“ genannt wurden, bildeten im Zuge ihres nomadischen Lebens eine eigene Kultur und Sprache heraus. Sie können als eigenständige, aber bisher noch nicht anerkannte Volksgruppe bezeichnet werden. Die Jenischen leben vor allem in (Süd)Tirol, Vorarlberg, Kärnten, in der Ostschweiz und im süddeutschen Raum. Ihr autonomer, nicht-bürgerlicher Lebensstil wurde von der sesshaften Gesellschaft zutiefst angefeindet und kriminalisiert. Der Ausgrenzung über die Jahrhunderte folgten in der NS-Zeit Maßnahmen wie Zwangssterilisierung und Deportationen in ein Konzentrationslager. Eine Wiedergutmachung und eine Aufarbeitung der Verfolgung der Jenischen im Nationalsozialismus sind bis heute nicht erfolgt.
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieben die Jenischen an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Die fortgesetzte Pathologisierung ihrer Lebensweise sorgte dafür, dass bis in die jüngste Zeit Diskriminierungen die Regel waren. Auch in den Jahrzehnten nach dem Krieg wurden jenische Kinder ihren Eltern entrissen und in Tiroler Erziehungsanstalten gebracht. Dass nicht wenige von ihnen dort nicht nur eine äußerst schlechte Behandlung erfuhren, sondern jahrelange Missbrauchserfahrungen machen mussten, ist bis heute ein besonders tabuisiertes Thema. Anfragen Betroffener auf Einsichtnahme in ihre Akten, um Antworten auf die quälenden Fragen zur eigenen Vergangenheit zu erhalten, werden von den Ämtern und den politisch Verantwortlichen immer wieder abgelehnt. Denn noch immer gilt TäterInnenschutz vor Opferschutz. Die folgende Geschichte steht symptomatisch für das vergessene und verdrängte Schicksal vieler jenischer Kinder in Tirol.
Beim Vater fühlte ich mich geborgen
Franz Pichler spricht gerne über die ersten Jahre seiner Kindheit. Er wirkt entspannt, ja beinahe gelöst. Ich war immer sehr vaterbezogen, ich habe ihn heiß geliebt, er war so was von einem feinen Menschen. Beim Vater fühlte ich mich geborgen, es war eine tolle jenische Kindheit. Geld gab es ebenso wenig wie einen Fernseher. Kinder wurden weder verwöhnt noch bevormundet, sondern ernst genommen. Vor dem Schlafen gehen erzählte der Vater viele aufregende und kuriose Geschichten. Gemeinsam mit Verwandten, Bekannten, Freunden und Freundinnen wurde musiziert, gesungen und viel geredet. Der Vater war ein wunderbarer Musiker und hochbegabter Handwerker. Ein jenisches Sprichwort besagt, dass es keine Jenischen gibt, die nicht mindestens drei Berufe auszuüben imstande sind. Wegen ihrer materiellen Notlage waren Jenische darauf angewiesen, in vielen Bereichen handwerkliches Geschick zu erwerben. Dieser Umstand hat auch das Leben von Franz Pichler geprägt. Wie selbstverständlich war er von klein auf in die Welt der Erwachsenen integriert und konnte sich in vielen Handfertigkeiten üben und mehrere Instrumente erlernen. Er begleitete den Vater zu den Plätzen, an denen Jenische, besonders aus der Schweiz, lagerten, die noch regelmäßig unterwegs waren, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. In seiner Jugend war der Vater selbst noch ein Fahrender gewesen, doch nach seiner Eheschließung wurde er sesshaft. Mit seiner Frau hatte er neun Kinder, fünf weitere brachte sie in die Ehe mit.
Sobald das Gespräch auf die Mutter kommt, verfinstert sich das Gesicht von Franz Pichler. Mutter war keine da, sie war nicht viel Wert, das muss ich leider ehrlich sagen, stößt er hastig aus und erzählt lieber, wie er beim Vater geschlafen hat, wie der Vater den ganzen Haushalt „geschupft“ und exzellent gekocht hat und dazu auch noch Geld verdienen gegangen ist. Und dass der Vater ihm so viel Liebe geben konnte, obwohl die Vergangenheit so schwer auf ihn lastete – Waisenhaus, Sonderschule, Verfolgung in der Nazizeit. Der Vater war ein Sozi durch und durch, nur nicht bei der Partei. Er hat zu uns immer gesagt: Alles dürft’s tun, aber nicht die ÖVP wählen. Der kleine Franz ging daher nicht in den Kindergarten, weil in der Nähe seiner Wohngegend nur ein katholisch geführter in Betracht gekommen wäre. Außerdem war ich evangelisch, ich weiß nicht warum.
Der Eintritt in die erste Klasse Volksschule in Amras markiert das Ende der materiell zwar kargen, aber glücklich erlebten Kindheit. Die traditionell stark von Jenischen bewohnten Siedlungen Innsbrucks – „Stalingrad“ (Premstraße – Burgendlandstraße), das Areal der Barackensiedlung des ehemaligen NS-Arbeitserziehungslagers Reichenau (östlicher Stadtrand von Innsbruck beim Städtischen Bauhof in der Rossau) und die Bocksiedlung (Gelände zwischen Langem Weg, Andechs- und Klappholzstraße) – bildeten eine Welt für sich mit eigenständigem sozialen Geflecht und kultureller Ausdrucksweise. Ihre BewohnerInnen zeichneten sich trotz vielerlei Streitigkeiten und interner Auseinandersetzungen durch ein großes solidarisches Gemeinschaftsgefühl aus, durch einen enormen Zusammenhalt gegen eine bürgerliche Außenwelt, die ihnen feindlich gesonnen war und sie an den Rand der Gesellschaft gedrängt hatte.
Mit dem Heraustreten aus der jenischen Solidargemeinschaft begann für den kleinen Franz der Ernst des Lebens im wahrsten Sinne des Wortes. Von Anfang an war er als Jenischer und Evangelischer in der Volksschule Amras nicht willkommen. Zumindest subjektiv empfand er, dass man ihn loswerden wollte. An der ersten Religionsstunde nahm er noch automatisch teil, bis der Pfarrer zu ihm sagte: Heidenbub, was suchst du da? Karrnerbub, du hast hier nichts verloren. Doch ausschlaggebend für seinen Abgang von der Schule nach kurzer Zeit war, dass ihn die Mutter zu sich nach Pradl holte, wo sie mit einem Beamten, der in der Tiroler Landesregierung tätig war, zusammenwohnte. Ich bin ihr immer wieder davongelaufen und zum Vater raus, oder ich bin zu ihm statt in die Schule zu gehen, aber das hat nichts geholfen.
Wenn Franz Pichler im Gespräch seinen Stiefvater H.M. kurz erwähnt und seine Mutter dabei so wenig wie möglich thematisiert, scheint er gefasst zu sprechen, doch seine wegwerfenden Handbewegungen und sein verächtlicher Blick lassen erahnen, welch unterdrückte Wut sich aufgestaut hat. Mutterbeziehung hat es null gegeben. Sie war eine Kandidatin fürs Kloster, so frömmlerisch, schließlich ist sie ja auch bei einem Geistlichen im Widum aufgewachsen.
Die Kindheit war schön – bis ich ins Heim kam
Franz Pichler atmet schwer, nach außen hin erzählt er scheinbar abgeklärt. Dann haben sie mich abgeholt mit einem schwarzen VW und ab nach Westendorf. Ich war keine sieben Jahre. Warum sie mich geholt haben, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das wäre das Interessante, wie das begründet ist so etwas. Bis heute ist ihm die Ursache seiner Unterbringung im Erziehungsheim in Westendorf unbekannt. War er zu aufsässig? Ist er zu oft von daheim fortgelaufen, um den Vater zu sehen? War die Mutter die treibende Kraft oder ihr Lebensgefährte mit seinen Verbindungen zu den Ämtern des Landes? Franz Pichler sinniert vor sich hin und findet keine Antwort. Er ist sich sicher, dass seine Heimunterbringung mit seiner jenischen Herkunft zu tun hat. Er weiß, dass er kein Einzelfall ist, dass viele Jenische zwangsweise in Heime untergebracht wurden, dass sie als „Karrner“ und „Asoziale“ beschimpft und eingestuft eine Verfolgungsgeschichte erleiden mussten, die sich von der Monarchie über die Erste Republik, Austrofaschismus, Nationalsozialismus und Zweite Republik erstreckt. Die Diskriminierung war in abgestuften Formen ständiger Begleiter der jenischen Volksgruppe.
Franz Pichler redet und redet. Er erinnert sich an die vielen Jenischen im Heim. Da waren der St. und der M., der R. und der H., was die mit uns aufgeführt haben! Er zählt die Namen der Erzieher in Westendorf auf, aber auch die Erzieherin war nicht viel besser. Das waren Schweine – Schweine waren das. Er beschreibt die sadistischen Praktiken, die Misshandlungen, sein Ausgeliefertsein.
Wer beim Essen gegen eine Regel verstieß, musste unter den langen Tisch kriechen und versuchen, auf der anderen Seite wieder hochzukommen. Währenddessen mussten die Zöglinge mit voller Wucht gegen den Körper des zu bestrafenden Kindes treten. Wer die Anordnung missachtete und zu sanft ausschlug, wurde dazu verurteilt, ebenfalls unter den Tisch zu kriechen.
Eine andere Spezialität war die „Watschengasse“. Unerlaubtes Sprechen und noch so geringe Verstöße gegen eine rigide Disziplinarordnung hatten Schläge in den verschiedensten Variationen zur Folge. So stellten sich die Kinder einander gegenüberstehend auf und ohrfeigten den Delinquenten, der das Spalier durchlief. Während der Studierstunden hatten die älteren Buben die jüngeren aufzuschreiben, wenn sie unaufmerksam waren. Als Belohnung durften sie dann an der gewalttätigen Ahndung des Regelverstoßes mitwirken. Das Durchpeitschen mit Haselnussstecken gehörte zu den milderen Bestrafungsritualen. Ebenso das Stunden lange Stillsitzen und Starren auf einen Punkt. Die Erzieherin ließ die Kinder so lange nicht aufs Klo gehen, bis sie sich in die Hose machten und deswegen wieder geschlagen wurden.
Die Schule befand sich im Heim. Mehrere Jahrgänge wurden gleichzeitig in einem Klassenzimmer unterrichtet. Die Kinder schrieben damals noch mit Tintenfedern. Wer einen Tintenkleckser verursachte, wurde mit dem Kopf auf den Tisch geschlagen oder mit einem Lineal traktiert. Ein Verstoß gegen die Abendruhe zog Kniebeugen mit ausgestreckten Händen, auf die ein schweres Buch gelegt wurde, nach sich. Auch gesungen haben wir oft, so Soldatenlieder. Es lebt der Schütze froh und frei oder Steige hoch du roter Adler. Ja, Tirol war angesagt, das schöne Vaterland. Sie haben uns schon eingebläut, was richtig ist.
Generell zielte die Heimpädagogik auf eine absichtliche Verrohung und Brutalisierung von Kindesbeinen an ab. Sie etablierte ein Spitzelsystem, das die Entsolidarisierung der Geschundenen förderte. Die Insassen des Erziehungsheimes in Westendorf befanden sich rund um die Uhr in der Anstalt. Ein Kontakt zur Außenwelt war kaum vorhanden. Fester Bestandteil des „Erziehungsprogramms“ war Arbeit – Erziehung durch Arbeit und Erziehung zur Arbeit. Neben dem Erziehungsheim befand sich ein Bauernhof, in dem die Zöglinge Hand anlegen mussten. Franz Pichler half beim Saustechen mit. Die blutige Angelegenheit war ihm als Kind aber zuviel. Als er einen Blutkuchen mit Kartoffeln essen sollte, versuchte er sich zu verweigern. Erst die Drohungen des Erziehers machten ihn schließlich gefügig. Da ein derartiger Essenszwang keine Seltenheit war, hatte er sich eine Schlucktechnik zu eigen gemacht, durch die er den Geschmack des zu sich Genommenen kaum mehr spürte. Doch bis heute löst eine Blutwurst Ekelgefühle in ihm aus.
Und dann hat der Missbrauch angefangen. Franz Pichler weiß, wo der Erzieher und Kinderschänder H.B., „das Oberschwein“, heute wohnt. Er ballt die Fäuste. Da hat er dich rausgeholt, hat dich hergetreten wie einen Esel, hat dich in sein Zimmer rein und dann bist missbraucht worden. Er hat versucht einzudringen, aber das ging dann eh nicht bei einem Siebenjährigen. Er hat es dann mit allen anderen sexuellen Mitteln probiert. Mit hundsgemeinen Schlägen hat er dich gefügig gemacht. Muss ich dir das jetzt in den Einzelheiten erzählen? Franz Pichler stockt und ringt nach Worten. Da muss ich jetzt nicht weiterreden, damit habe ich ein wenig ein Problem, auf jeden Fall war es damals ein Problem für mich, aber nicht nur für mich, sondern für einige andere auch.
Der „schnelle Hirsch“
Um den PeinigerInnen zu entkommen, versucht Franz Pichler wiederholt aus dem Erziehungsheim Westendorf zu flüchten. Bereits am Tag seiner Einlieferung läuft er davon. Er flieht in aller Frühe aus dem Sommer-Zeltlager. Er rennt nach Hause zur Mutter, die ihn gleich wieder übergibt. Aber was glaubst du, wie ich mich in der Nacht im Wald gefurchten habe als kleiner Bub. Dennoch, wo immer sich ihm eine Gelegenheit bietet, geht er „stiften“. Ich war der schnelle Hirsch, sagt er und lacht, obwohl ihm nicht zum Lachen zumute ist. Als mich die Mutter wieder zurückgebracht hat, habe ich gewusst, ich kann nicht heim, ich muss mich allein durchschlagen. Zum Vater kann Franz Pichler auch nicht. Der war schon vergraben, den haben sie fertig gemacht und Stück für Stück vernichtet. Er hat den sozialen Druck nicht mehr ausgehalten. Und dann hat er auch angefangen zu trinken, da geht’s dann noch schneller bergab. So ist er weggekommen nach Hall in die Klinik, dort ist er dann ein Wrack geworden. In der Nacht habe ich gebetet, bitte lass den Vater nicht sterben, sonst sehe ich überhaupt kein Licht mehr. Ich habe nur gewusst, es läuft etwas Böses. Ich habe es nur nicht benennen können.
Ein Besuch der Mutter hat sich unauslöschlich ins Gedächtnis von Franz Pichler gebrannt. Sie kam in Männerbegleitung mit dem Auto. Der kleine Franz erhoffte sich Hilfe und erzählte ihr von seinen Qualen. Doch die Mutter schenkte ihm kein Vertrauen. Schließlich ließ sie sich doch erweichen und fragte zumindest bei der Heimleitung nach, die natürlich alles in Abrede stellte und Franz als Phantasten hinstellte. Als die Mutter im Begriff war heimzufahren, krallte er sich verzweifelt an der Stoßstange fest. Doch die Mutter schlug ihm auf die Finger, sodass er loslassen musste. Seitdem habe ich mit der Frau abgeschlossen gehabt, das werde ich nie vergessen, nie. Dass Franz, kaum dass der Besuch außer Sichtweite war, wieder geschlagen wurde, versteht sich von selbst.
Die Strafen für Fluchtversuche waren drakonisch. Zunächst wurde den Kindern eine Glatze geschoren, um sie als Flüchtlinge kenntlich zu machen und zu demütigen. Doch das Schlimmste war eine Prozedur, bei der er nackt ausgezogen wurde und mit den schlanken Ästen einer Trauerweide im Hof, deren Standort und Gestalt er noch bis ins Detail beschreiben kann, ausgepeitscht wurde. Franz Pichler hört noch heute das grausige Pfeifen des Folterinstruments, das blutige Striemen auf seiner blanken Haut verursachte. Das anschließende Auftragen von Wundbenzin sorgte dafür, dass er sich vor Schmerz krümmte. So war es halt. Den ganzen Tag Schläge. Ich kann mich nur erinnern, in diesen ganzen vier Jahren, ich bin in der Früh aufgestanden mit Angst und ich bin in der Nacht schlafen gegangen mit Angst.
Als Franz in das Heim Pechegarten nach Innsbruck kommt, fühlt er sich wie in einem Fünf-Sterne-Hotel. Während sich in Westendorf das gesamte Leben in der Anstalt abspielte, kann er sich in der Stadt nun auch außerhalb der Heimmauern aufhalten. Er geht in die Hauptschule Leopoldstraße. Der Besuch einer Hauptschule stellte für jenische Kinder eine Seltenheit dar. Franz hatte nach den vielen vergeblichen Fluchtversuchen in Westendorf auf Lernen als Überlebensstrategie umgeschaltet. Doch auch in der Innsbrucker Hauptschule fand er zum Teil höchst gehässige Lehrkräfte vor. Seine jenische Herkunft blieb ein entscheidender Makel, der ihn zum Außenseiter stempelte. Demütigungen begleiteten ihn während der gesamten Schullaufbahn.
Im Heim erkrankte er an Hepatitis B. Über die Ursache kann er nur Vermutungen anstellen. Franz Pichler wurde daraufhin wieder in die Obhut der Mutter überstellt. Über diesen Zeitabschnitt will er nicht sprechen. Sie hat zu spinnen begonnen, sie war grauslich zu allen Kindern. Sie war von Grund auf verhetzt von den Pfaffen. Er weiß, dass er manchmal irrational reagiert, aber der Hass auf alles, was mit Kirche zu tun hat, sitzt aufgrund seiner Erfahrungen zu tief. Mit denen habe ich nur Negatives erlebt, egal ob katholisch oder evangelisch. Ausnahmen wie der Meinrad Schumacher, der heute bei den Altkatholischen ist, waren selten. Der hat keine Unterschiede gemacht, der hat dich nicht spüren lassen, dass du zu den Jenischen gehörst. Sonst war es immer dasselbe, du warst nicht Schicht 2, wir waren Schicht 3 oder 4. Das war so, du kannst jeden von den Geschwistern fragen. Wenn er mit dir reden will, wird er dir das Gleiche sagen. Alle Geschwister sind in der Sonderschule gewesen. Jenische hat man fast immer von vorneherein da reingesteckt.
Endlich Ruhe finden
Franz Pichler gelang es mit einem ordentlichen Schulabschluss eine Lehre zu absolvieren. Doch er zeigte sich widerspenstig und aufbrausend. Gegenüber seiner Umwelt war er im äußersten Maße misstrauisch. Von niemandem wollte er sich mehr etwas gefallen lassen. Nie mehr sollte ihn wer schlagen oder demütigen. Nun schlug er zurück. Das war auch mein großes Verhängnis. Ich bin dann richtig ausgerastet. So konnte es nicht ausbleiben, dass er auch mit dem Gesetz in Konflikt kam.
Franz heiratete sehr jung und hatte eine Familie zu versorgen, ein Kind war rasch unterwegs. Eine anständige Arbeit, die seiner Ausbildung entsprach, bekam er nicht. Immer wieder wurde er abgewiesen. Ein Jenischer. Du konntest dich noch so bemühen, nie war etwas richtig. Aber wenn es um Arbeiten ging, die andere nicht machen wollten, dazu war man gut genug. Schwerarbeit und so. Samstag, Sonntag durch. Überstunden für ein paar Groschen. Da waren wir schon recht. Ich bin am Tag mit dem Kipper gefahren, abends mit der Mischmaschine. Ich habe gehackelt rund um die Uhr, genützt hat es nichts, das war alles sinnlos. Was Gescheites hast nicht gekriegt.
Schließlich versuchte Franz Pichler sich und seiner Familie eine gesicherte Existenz aufzubauen, indem er ins Ausland ging. Dort musste er zwar unter widrigen Umständen schwere Arbeit verrichten, aber er verdiente sehr viel Geld. Als ein Bürgerkrieg ausbrach, war er gezwungen auf abenteuerliche Weise das Land wieder zu verlassen. Er erlebte mit, wie Menschen aus nächster Nähe erschossen wurden.
Trotz vielfältiger Schwierigkeiten konnte Franz in der Heimat Fuß fassen. Zu seinem Glück hatte er noch eine zweite Einnahmequelle. Er war ein sehr talentierter Musiker und verfügte auch über eine gute Stimme. Ohne die Musik, davon ist er fest überzeugt, wäre er gescheitert. Die Musik, von der er lange Zeit gut leben konnte, musste er inzwischen wieder aufgegeben. Heute rottet das Tonstudio, in das er erhebliche Mittel investiert hat, vor sich hin. Gegen die Musikindustrie gab es schlussendlich kein Aufkommen. Eine Mafia, aber das ist eine lange Geschichte.
Die Vergangenheit lässt Franz Pichler jedoch nicht so leicht los. In periodischen Abständen wird er von Depressionen heimgesucht. Sein Halt war und ist die Familie, die Frau. Ich habe meine Familie schön durchgebracht. Die Frau musste früher nicht arbeiten, dann bin ich krank geworden. Flachgelegen. Da war auch so ein Gefühl, entweder ich bringe mich um, oder der Nächste, der mir zu nahe kommt, muss dran glauben. Die Sehnsucht nach einem Ende war schon immer wieder da. Ich kann nur nicht, weil ich eine Familie habe. Ich fürchte mich nicht. Ich habe keine Angst mehr. Was soll mir noch passieren, wovor soll ich mich fürchten. Schlimmer geht es, mein ich, nimmer. Da habe ich keine Angst. Dazu hat man mir schon viel zu viel zugefügt. Mit dem kann ich mittlerweile umgehen. Doch eines schönen Tages wirst du leer. Mein ganzes Leben lang habe ich geschaut, dass Geld für die Familie da ist. Ich war immer kampfbereit. Ich habe mir gesagt, du musst dich in die Gesellschaft hineinintegrieren. Du kannst nicht überall etwas Schlechtes sehen. Dann habe ich gemerkt, so kann es nicht weitergehen.
Franz Pichler beschäftigt sich intensiv mit Geschichte. Er will Zusammenhänge erkennen, um seine eigene Vergangenheit zu verstehen, von der für ihn so vieles im Dunklen liegt. Ich habe ein paar Erklärungen gefunden. Bis jetzt habe ich ja nur gewusst, es stimmt etwas nicht, aber warum wieso, das war mir unklar.
Auf die Frage nach seiner Lebensphilosophie antwortet er: Lass mich frei sein, das ist für mich das um und auf und mit mir normal umgehen. Ich bin nicht besser, aber auch nicht schlechter. Ich bin nicht faul, aber wenn ich mich ausgebeutet fühle, mache ich zu, dann ist Schluss. Befehlen lasse ich mir nichts mehr.
Franz Pichler will endlich Ruhe finden und einen neuen Sinn. Er möchte eine Arbeit ausüben, bei der er einigermaßen frei ist und seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Es ist ihm gelungen, einen wichtigen Schritt zu machen. Er hat eine Therapie begonnen. Ich muss momentan auf mich schauen, alles umgraben und mich für die Zukunft ganz neu orientieren.