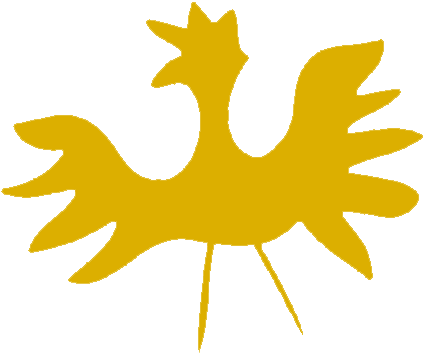Vertuschen, wegschauen, Verantwortung abschieben
zurück zu „Wie war es möglich“
Wissen über die unhaltbaren Praktiken in den Kinder- und Fürsorgeerziehungsheime gab es zu jedem Zeitpunkt ihres Bestehens. Zahlreiche Missstände wurden in internen Berichten der Jugendämter erwähnt, immer wieder erzählten Heimkinder über ihr Martyrium, Eltern beschwerten sich. Auch in der Psychiatrie kamen die Brutalitäten der Heimerziehung zur Sprache.
Die Heime waren in der Öffentlichkeit verrufen, bei Eltern und selbst in der Exekutive und bei einem Teil der RichterInnen und der Lehrerschaft. Sie dienten als Abschreckung und Drohung: „Wannst net brav bist, kommst ins Heim“.
Kamen Gewaltexzesse und sexuelle Übergriffe ans Tageslicht, wurde versucht, sie zu vertuschen oder als individuelles Versagen Einzelner hinzustellen. Deshalb änderten auch Anzeigen nichts, die, was selten genug war, zu Gerichtsprozessen führten, selbst bei Verurteilung der TäterInnen. Allzuoft wurden Heimkinder, die ihr Leid klagten, eingeschüchtert, mundtot gemacht, als LügnerInnen bloßgestellt. Es war möglich, weil fast alle wegschauten.
Und weil die Denkmuster und Praktiken der Macht und der Mächtigen schließlich in der Bevölkerung akzeptiert, übernommen und getragen wurden.
Es gab immer formale Verantwortlichkeiten, die nicht real wahrgenommen wurden, und stets verantwortliche Menschen in einer Kette von Zuständigkeiten, welche die Heimkinder begleiten hätten müssen – es aber nicht taten. Jugendämter informierten sich unzureichend, wie es den Kindern ging, Vormundschaftsrichter überprüften nicht, Ärzte und LehrerInnen reagierten kaum, wenn die Spuren der Gewalt unübersehbar waren, Staatsanwälte verfolgten Anzeigen nicht weiter, die Politik nahm ihre Aufsichtspflicht nicht wahr oder übte sogar massiven Druck auf diejenigen aus, die Missstände aufzeigten. Kontrollen blieben aus. Das Land war – über die Jugendämter – einweisende Instanz, gleichzeitig aber auch Heimträger, und, es übte die Aufsicht aus. Eine Heimaufsicht gab es de facto also gar nicht, die Minderjährigen verfügten im Heim über keinen Schutz. Mit ihnen wurde sowieso nicht gesprochen, nur über sie.
Die ausführenden Landesgesetze zum Bundesjugendwohlfahrtsgesetz von 1954 enthielten die Aufforderung, alles für das Kindeswohl zu unternehmen und sich regelmäßig durch Nachschau um die Schutzempfohlenen zu kümmern. Dabei sollte die Fremdunterbringung die gedeihliche Entwicklung des Minderjährigen sichern und für eine zukunftsträchtige Berufsausbildung sorgen. Die Fürsorgeerziehung war entsprechend den pädagogisch-psychologischen Erkenntnissen der Zeit zu gestalten. In all diesen Forderungen kam es in der Realität zu schwerwiegenden Versäumnissen, die sich äußerst negativ auf die Betroffenen während ihrer Zeit im Heim (und in Pflegefamilien) als auch in ihrem späteren Leben auswirkten. Bereits im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) von 1811/12, in dem das Kind erstmals als Rechtssubjekt genannt wurde, heißt es im § 21: „Minderjährige (...) stehen unter dem besonderen Schutz der Gesetze.“
Gute, alte Zeit? Jahrzehnte lang nach 1945 nicht, wenn es um Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen ging. Gerade diesen besonders Schutzbedürftigen wurden menschliche Wärme, Fürsorge, Bildung und Ausbildung, Würde und Stärkung des Selbst vorenthalten. In einer Welt der Gewalt lebten viele Kinder und Jugendliche, die „gesunde Watschn“ wurden auch in vielen bürgerlichen Familien und in der Schule großzügig ausgeteilt; sie galt lange als probates Erziehungsmittel. Doch die exzessive Gewalt und Erniedrigung in den Heimen war zu jedem Zeitpunkt gesetzlich verboten und ging wesentlich über das elterliche Züchtigungsrecht hinaus.