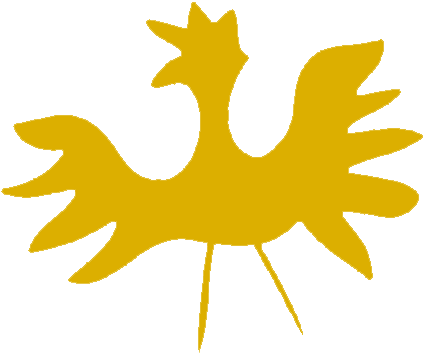Die ErzieherInnen
zurück zu „Wie war es möglich“
Elfriede Haglmayer, Leiterin des Landeserziehungsheimes Kramsach-Mariatal, unterstrich 1951, dass man mit Bezug auf die Frage, wie und warum jemand in Tirol ErzieherIn wurde, „zum Teil zu sehr ernüchternden und deprimierenden Feststellungen“ komme. Sie sprach von vielen ehemaligen Nazis, die nicht mehr in ihren früheren Beruf zurückkehren konnten und völlig ohne Ausbildung „verbittert“ in den Heimen untergekommen waren. Zu ihnen würden sich die DauerkritikerInnen und NörglerInnen gesellen, vor allem aber Lehrkräfte, die entlassen worden waren oder aus sonstigen Gründen nicht mehr unterrichten konnten sowie Kindergärtnerinnen ohne Jobmöglichkeit.
Das Qualifikationsdefizit war und blieb haarsträubend. Die erste Bildungsanstalt für ErzieherInnen öffnete erst 1960 in Baden bei Wien. Doch bis 1980 musste auch dieses Bundesinsitut für Heimerziehung auf Sparflamme tätig sein, es konnte nur eine einjährige Ausbildung für MaturantInnen und eine zweijährige für BewerberInnen mit einer drei Jahre über die Pflichtschule hinausgehenden Schulbildung angeboten werden. Die Regel blieb eine Ausbildung in Form von Externistenkursen und Fortbildungen. Die meisten ErzieherInnen kamen berufsfremd zum Einsatz. Doch auch diese Fortbildungen waren nicht auf die anspruchsvolle Heimpädagogik ausgerichtet, sondern auf ErzieherInnen in Lehrlings- und SchülerInneninternaten. In Tirol lag die sozialpädagogische Ausbildung in der Hand der katholischen Kirche. Die Bildungsanstalt für Erzieher der Diözese Innsbruck in Pfaffenhofen wurde 1973 gegründet, jene in Zams 1985. Damit hatte nur Wien (1962) rascher reagiert, dann folgte Niederösterreich (St. Pölten 1980). 1946 wurde von der Caritas in Innsbruck eine „Fürsorgerinnenschule“ ins Leben gerufen, die 1948 als erster Schultyp dieser Art in Österreich das Öffentlichkeitsrecht erhielt.
Noch Mitte der 1970er Jahre sah es bezüglich des Ausbildungsniveaus in österreichischen Fürsorgeheimen düster aus. Eine repräsentative Studie erhob, dass vier Fünftel der ErzieherInnen lediglich über einen Pflichtschulabschluss, ein Fünftel über die Matura. Mehr als drei Viertel der ErzieherInnen, die vor ihrem Eintritt in ein Fürsorgeheim einen Beruf ausgeübt hatten, waren nicht in pädagogisch-sozialen Berufszweigen tätig gewesen. Die Mehrzahl der ErzieherInnen wurde ohne Qualifikation eingestellt. Wenn es eine Ausbildung gab, dann in berufsbegleitenden Kursen, meist in Form von „Erzieherfachdienstkursen“ der Landesbehörden.
HeimerzieherInnen galten als das Proletariat der sozialen Berufe. Für den sozialen Aufstieg waren viele bereit, sich mit den Normen und Werten jener Mittelschicht zu identifizieren, die sie erreichen wollten. Der tägliche Umgang mit den aus elenden Lebensverhältnissen kommenden Heranwachsenden konnte als unbewusste Bedrohung aufgefasst werden, spiegelten sie doch jene soziale Lage wider, der viele der ErzieherInnen zu entgehen hofften. Abwehrhaltungen, Ängste und Aggressionen richteten sich demgemäß gegen die zu Erziehenden.
Dabei war eine ganze Reihe von ErzieherInnen bei Dienstantritt von besten Vorsätzen erfüllt, den Zöglingen zur Seite zu stehen. Alleine die mehr als unzulänglichen Rahmenbedingungen des Heimes verhinderten vielfach die Umsetzung der idealistischen Vorstellungen. Die Gruppen waren für eine individuelle Betreuung zu groß, die räumlichen und materiellen Voraussetzungen waren schlecht und die völlig ungenügende Ausbildung überforderte nicht nur, sie schuf Aggressionen gegen die scheinbar unwilligen und widerspenstigen Zöglinge.
Chronische Frustration, mangelnde Erfolgserlebnisse und fehlende Wertschätzung der Vorgesetzten, ohne dass sich eine Aussicht auf eine grundlegende Verbesserung der Situation ergeben hätte, förderten den Rückfall in einen offen repressiven und autoritären Erziehungsstil und schließlich in völlige Resignation. In abhängiger Stellung ohne relevante Entscheidungskompetenzen und in einer Situation des Gruppendruckes, der ein abweichendes Verhalten nur mit viel Zivilcourage oder Gefährdung der eigenen Stellung erlaubte, arrangierten sich viele, um schließlich die kleineren und größeren Vergünstigungen des „Jobs“ zu genießen.
Dabei ist das korrumpierende Gefühl der Macht über andere, die dem eigenen Willen schutzlos ausgeliefert sind, nicht außer Acht zu lassen. Der Schritt von einem Machtverhältnis, das jede Erziehungskonstellation darstellt, zu einem Gewaltverhältnis war und ist klein. Die Heimleitungen, Jugendämter und die Politik stützten die ErzieherInnen mehrheitlich nicht. Sie legten selbst übermäßige Härte an den Tag oder forderten diese ein. Die VerantwortungsträgerInnen ließen ihre Untergebenen die „Drecksarbeit“ machen und sahen geflissentlich dort weg, wo Hinschauen angesagt gewesen wäre. Anpassung und Gewalt stellten mit der Zeit Verhaltensweisen bei Menschen dar, die in Ermangelung beruflicher Professionalität hilflos den hohen Anforderungen von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen gegenüberstanden.
Hinzu gesellten sich überlange Arbeitszeiten, die das Privatleben beschnitten, und der Umstand, dass viele oft über Nacht im Heim Dienst verrichteten, also teils selbst HeimbewohnerInnen waren. Dabei war die Bezahlung wenig attraktiv und das Berufsprestige gering. Der schlechte Ruf der Kinder und Jugendlichen konnte durchaus auf ihre ErzieherInnen abfärben. Wer wollte sich freiwillig mit den „Verwahrlosten“ und „Schwererziehbaren“ abgeben? Verhaltensauffällige, SadistInnen, Perverse, Beziehungsunfähige und Gescheiterte fanden hinter den geschlossenen Mauern der Heime genügend Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Dieser Typus von ErzieherIn konnte unter dem Deckmantel der Erziehung Missratener zu ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft die eigenen Persönlichkeitsdefizite ungehindert ausleben.
Eine problematische Situation fand auch das geistliche Erziehungspersonal vor. Es arbeitete quasi für Gottes Lohn, erhielt nur ein Taschengeld und verfügte über noch weniger Ausbildung und Intimsphäre als ihre weltlichen KollegInnen. In den katholischen Kinder- und Fürsorgeheimen schliefen die Schwestern meist im selben Raum wie die Zöglinge oder in unmittelbarer räumlicher Nähe. Das Klosterleben forderte von ihnen außerordentlichen Fleiß, Gehorsam sowie Disziplin und Selbsthärte. Die abstrakte Liebe zu und von Gott mit allzu wenig real gelebter Erfahrung von Zuneigung und Geborgenheit durch konkrete Menschen machte viele unfähig, die ihnen schutzempfohlenen Kinder und Jugendlichen anzunehmen, sie zu herzen und liebevoll zu umsorgen. Nach Arbeitsschluss konnten sie in kein eigenes Leben gehen, sie hatten nicht einmal die Perspektive, so wie die Kinder und Jugendlichen je einmal das Heim zu verlassen. Diese Sozialisationsbedingungen und Lebensperspektiven dürften bei vielen geistlichen ErzieherInnen dazu beigetragen haben, dass sie ebenso liebes- wie beziehungsunfähig waren und ein hohes Aggressionspotential gegen die Heranwachsenden entwickelten. Wie unerbittlich streng und entwürdigend sie erzogen, dürfte ihnen nicht aufgefallen sein, lebten sie doch zu einem bestimmten Teil den Heimzöglingen nicht unähnlich, auch wenn sie sich selbst Vergünstigungen zugestanden, etwa besseres Essen.
Bei Nonnen und Patres herrschte die Vorstellung vor, dass Schläge und Drill die Heranwachsenden zu gottgefälligen Menschen machen würden. Jede eigene menschliche Regung galt bereits als Schwäche oder Sünde. Uneheliche Kinder hatten es als „Kinder der Sünde“ besonders schwer bei den geistlichen Schwestern, die das Menschenbild der katholischen Kirche verinnerlicht hatten. Dementsprechend sah auch die Behandlung dieser Schutzempfohlenen aus. Generell steckte ja nach Ansicht der Klostererziehung in jedem Kind das Böse – Stichwort Erbsünde –, das bekämpft werden musste. Damit verbunden war dann die Tendenz, das Böse aus den Kindern herauszuschlagen und ihren Willen zu brechen.
Auffällig ist auch, dass die Verständnisvollen und Umsichtigen, die Feinfühligen und Herzlichen einen schweren Stand hatten. In den weltlichen wie in den geistlichen Anstalten. Oft standen sie in der ErzieherInnenhierarchie an den unteren Positionen oder verschwanden bald aus dem Blickwinkel der Heranwachsenden. Die Sensibleren in den städtischen Jugend- und Kinderheimen sowie in den Landeserziehungsheimen hielten die Atmosphäre dort nicht allzu lange aus. In den Fürsorgeeinrichtungen herrschte eine hohe Fluktuation. Belohnt oder gefördert wurden sie von Vorgesetzten und Behörden kaum, Supervision gab es ebenso wenig wie Freiräume für innovatives pädagogisches Handeln. Umso positiver ist das Verhalten all jener ErzieherInnen einzuschätzen, die sich mit den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen identifizierten und nicht gewillt waren, reibungslos zu funktionieren. Schwer genug hatten sie es und wurde es ihnen gemacht. „Das System Heimerziehung funktionierte nur, indem auch Mitarbeiter, die andere Vorstellung von ‚Fürsorge‘ hatten, gebrochen wurden“, unterstreicht Manfred Kappeler. Bert Breit formulierte den Umstand, dass die „totale Institution“ Heim auch auf die ErzieherInnen wirkte, in seiner Studie über die Zustände im Landeserziehungsheim Schwaz nach vielen Interviews so:
„Nicht etwa deshalb, weil das Heimpersonal aus Sadisten und Sadistinnen bestand, nahm diese Gewalt oft zerstörende, quälerische Formen an. Die Situation der Erzieherinnen und Erzieher war aussichtslos: Eingesperrte Jugendliche, die unter vielfachen Beschädigungen und Mängeln litten, im Sinne der bestehenden Ordnung zu ‚erziehen‘, musste scheitern. Die Einsichtigen unter dem Heimpersonal, die guten Willens waren, aber die Probleme rechtzeitig erkannten, wechselten den Beruf; andre resignierten, versahen ihre Arbeit ‚nach Vorschrift‘ mit kalter Routine. Und einige, fachlich unzureichend ausgebildet, unsicher gemacht durch ständig wechselnde Vorschriften, voller Hass auf die Jugendlichen, die sie nicht ‚in den Griff‘ bekamen, entwickelten Methoden, um das, was die Sozialbürokratie von ihnen verlangte, mit Gewalt durchzusetzen.“