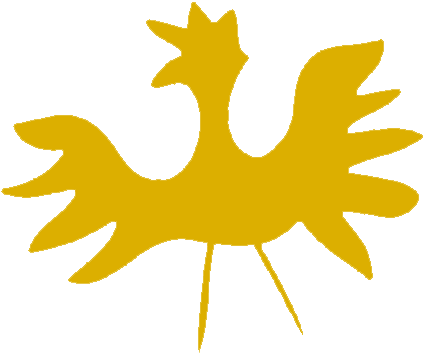Der Körper
Alle Interviewten zeigten sich über die Qualität der Nahrung und die Begleiterscheinungen ihrer Verabreichung im höchsten Maße unzufrieden und empört. Die Lieblosigkeit, mit der die Mahlzeiten zubereitet wurden und zu sich genommen werden mussten, war eklatant und versinnbildlichte bereits die Missachtung der Heimkinder. „Für uns Fürsorgekinder war das Essen ein Grauen. Dabei waren wir überhaupt keine verwöhnten Kinder, da wir arm waren“, betont Julia Wegner, die gegen Ende der Woche in Scharnitz eine zusammengemischte Mahlzeit aus übrig gebliebenen Essensresten wie in einem „Schweinetrog“ verabreicht bekam. Das Essen in Kleinvolderberg war miserabel, eine Reihe von Zöglingen kam aus derart verarmten Familien, dass sie froh waren, sich wenigstens satt essen zu können. In einigen Heimen wurden die Kinder um ihr Essen betrogen, sie litten Hunger – selbst noch in den 1970er Jahren. Erzieherinnen und Erzieher, Patres und Klosterschwestern ließen es sich gut gehen, zu Lasten der Kinder. Julia Wegner erzählt über eine besonders skandalöse und demütigende Praktik der Schwester Oberin aus Scharnitz, die ihren Hund vor den Augen der Kinder mit Sahnetörtchen fütterte. „Da fühlte ich mich komplett wertlos“, sagt sie. Aus fast allen Heimen wird berichtet, dass es einen regelrechten „Überlebenskampf“ um das Essen gab, bei dem die Jüngeren gegenüber den Älteren den Kürzeren zogen. Die ErzieherInnen griffen nicht schlichtend zugunsten der Schwächeren ein. Diese Praktik gehörte zu den Erziehungsmethoden und diente auch gezielt der Entsolidarisierung.
Zahlreiche Interviewte berichten über ausgesprochene Zwangsmaßnahmen bis hin zu Schlägen, wenn nicht aufgegessen wurde. Einige Kinder mussten Erbrochenes aufessen. Strafen wegen ungebührlichen Benehmens bei Tisch waren das Verbinden der Augen oder die Zurschaustellung vor den anderen, etwa durch das Tragen einer Hexenmaske aus Gummi. Alle Befragten kannten Essensentzug als Strafe, für die kleinen Kinder war das Streichen des Abendessens, des geliebten Sonntagsnachtisches oder der sonntäglichen Frühstückssemmel besonders schlimm. Wer von daheim etwas zugesteckt bekam, gehörte zu den Glücklichen. Allerdings bedurfte es einiger Geschicklichkeit, um die Lebensmittel und Süßigkeiten vor den ErzieherInnen zu verstecken. Sie trachteten danach, den Kindern dieses Zubrot abzunehmen.
Auch das Waschen gehört zu den vielfältigen Formen körperlicher Missachtung in den Heimen. Die Hygiene war oft mit Grobheit und einer ablehnenden Körpersprache seitens der ErzieherInnen verbunden. Alles musste schnell gehen, die Kinder in rascher Folge abgefertigt werden. Die sanitären Einrichtungen einiger Heime wie in Kramsach-Mariatal oder Kleinvolderberg waren völlig desolat. Meist konnte nur einmal in der Woche geduscht oder gebadet werden, der Kleiderwechsel erfolgte in der Regel alle 14 Tage. Mehrere Befragte berichten, dass sie sich geschämt hätten, weil sie so muffelten. Überhaupt wurden die Mädchen in den Landeserziehungsheimen gezwungen, über der Kleidung Schürzen zu tragen, die sie uniformierten und als Zöglinge markierten.
Übertriebene Sparsamkeit, desolate Waschanlagen und das Streben, den Arbeitsaufwand pro ErzieherIn in für sie erträglichen Grenzen zu halten, bewirkten eine äußerliche Vernachlässigung. In der Bubenburg in Fügen wurde zwar in den 1970er Jahren das Duschen in Badehosen von einem Laienerzieher abgestellt, dafür gab er ausufernde Anweisungen zur Reinigung des Penis, den er auch im Zuge seiner berüchtigten „Sportmassagen“ bearbeitete. Roswitha Lechner berichtet, dass sie den Intimbereich in St. Martin in Schwaz verstohlen unter dem Nachthemd waschen musste. Aloisia Wachter erwähnt Nonnen in Martinsbühel, die mit der Bibel in der Hand bei der Körperreinigung zusahen, damit keine Dummheiten gemacht wurden. Sexualisierte Gewalt beim Waschen – erzwungene Zurschaustellung, Verhöhnung körperlicher Beschaffenheit, Anfassen – kam häufig vor, auch durch Frauen. Versteckte Gewalt äußerte sich bei der Körperpflege von Kindern nicht nur durch unsanfte Berührungen oder zu heißes oder zu kaltes Wasser. Das Schneiden der Nägel verursachte so manchen willkürlich augelösten Schmerz.
Bereits die Körperreinigung verweist auf das absolute Tabuthema Sexualität. Nirgends wurden die Kinder und Jugendlichen menschenfreundlich aufgeklärt, bei den Mädchen herrschte eine noch größere Tabuisierung. Die Geschlechter wurden in den Heimen nicht nur strikt getrennt, die weiblichen Befragten berichten von zahlreichen Beschimpfungen. Sie seien schmutzig, liederlich, dirnenhaft oder würden als Prostituierte enden. Lesbische Beziehungen waren im hohen Maße verpönt, gesprochen wurde darüber seitens der Erwachsenen nicht, was es gab, waren Sanktionen. Bei den Burschen kam es vielfach untereinander zu einem sexualisierten Verhalten oder gar zu Übergriffen, die nicht thematisiert wurden. Schutz boten die Erzieherinnen und Erzieher in der Regel keinen.
Übereinstimmend kritisieren die Befragten die mangelnde ärztliche Versorgung bei körperlichen Beschwerden, Krankheit und Verletzungen. Vielfach wurden sie ignoriert, sodass Krankheiten verschleppt oder gesundheitsbedrohliche Situationen heraufbeschworen wurden. Ehemalige Heimkinder, die Einsicht in ihre Heim- oder Fürsorgeakten erhalten haben, zeigen sich verwundert über fehlende, falsche oder verharmlosende Eintragungen, selbst bei schwerwiegenden Vorfällen. „War man krank, hatte man Schmerzen, brauchte man Hilfe, dann wurde einem bald klar, dass man am falschen Ort war. Aber von diesem durfte man sich nicht entfernen“, klärt Walter Müller über seine Erfahrungen in Kleinvolderberg auf. Statt Hilfe bekam der Bruder von Karlheinz L. in Westendorf wegen seines schweren Heuschnupfens Schläge auf den Kopf. Mercedes Kaiser musste in Kramsach-Mariatal erfahren, dass Kinder, die wegen Schmerzen jammerten, eine „Gnackwatschn“ erhielten. Dass selbst kleine Kinder nur ein Ärgernis darstellten, weil ihre Pflege Arbeitszeit erforderte, berichtet Julia Wegner. Sie wurde in Scharnitz krank aus dem Bett gerissen und durch das ganze Gebäude bis in die Schule an den Haaren gezogen. Christine Specht gibt an, dass sie wie andere Kinder in Mariahilf im so genannten Krankenzimmer stundenlang ohne Essen und Trinken alleine gelassen wurde und Ohrfeigen bekam.